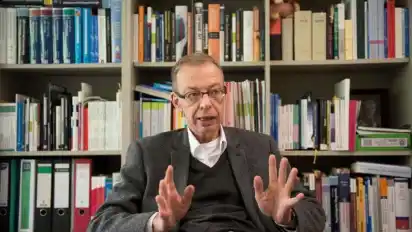In Bremen ist es jüngst zu vier Vorfällen gekommen, bei denen Polizisten im Fokus von Attacken standen. Nur eine zufällige Häufung von Gewalt gegen Polizisten oder Teil einer langjährigen Entwicklung?
Zuletzt gab es in Bremen in nur drei Wochen vier verschiedene Vorfälle, bei denen die Polizei im Fokus von Attacken und gewalttätigen Übergriffen stand. Eine Gruppe griff am 16. Dezember im Viertel einen Streifenwagen mit Schreckschusspistole und Pflastersteinen an. Diskogänger verletzten am zweiten Weihnachtstag am Hillmannplatz vier Polizisten, einem Beamten wurde dabei die Schulter ausgekugelt. In der Neujahrsnacht beschossen vermutlich drei junge Männer die Polizeiwache in Lesum gezielt mit Feuerwerkskörpern. Und zuletzt verletzte am vergangenen Wochenende ein 16-jähriger Jugendlicher im Landgericht einen Polizeimitarbeiter durch Tritte gegen den Kopf. Der Jugendliche war der Polizei bereits seit 2014 durch verschiedene Raub-, Einbruchs- und Körperverletzungsdelikte bekannt.
Nur eine zufällige Häufung von Gewalt gegen Polizisten oder Teil einer langjährigen Entwicklung? Die Gewerkschaft der Polizei kritisiert seit Jahren sinkende Hemmschwellen und wachsende Gewaltbereitschaft. Nun nennt die Bremer Polizei neue Zahlen: Seit 2011 stelle man in Bremen eine kontinuierlich ansteigende Zahl von Gewaltvorfällen gegen Polizeibeamte fest, sagt Polizeisprecher Dirk Siemering. 2011 habe es 299 solcher Taten gegeben, 2012, 2013 und 2014 bereits über 360 Taten. Für 2015 seien derzeit noch nicht alle Fälle gezählt, doch die Zahl der Gewalttaten sei auf mindestens 418 Fälle gestiegen.
„Die gefühlte Qualität der Gewalt hat sich für uns erhöht“, sagt Siemering. „Zum Teil ist eine Brutalisierung feststellbar.“ Die Polizei betrachte die zunehmende Gewaltbereitschaft mit Sorge. Erschreckend sei „insbesondere die Gewaltanwendung durch unbegleitete minderjährige Ausländer“, aber auch die „teilweise erkennbar organisierte Gewaltbereitschaft aus dem Umfeld der gewaltbereiten und gewalttätigen Ultras und der linksautonomen Szene“. Es gebe auch zunehmend eine Gewaltbereitschaft, wenn Polizisten zur Schlichtung von Familienstreitigkeiten und Fehden im Einsatz seien.
Wie viele Beamte 2015 verletzt wurden, kann die Polizei nicht sagen. Doch häufig blieben Polizisten nur durch glückliche Umstände unverletzt, sagt Siemering – etwa, wenn unvermittelt Steine oder Flaschen geworfen würden. Nach Vorfällen wie dem Angriff auf den Streifenwagen würden auch Traumatisierungen eine erhebliche Rolle spielen.
Auch die Innenbehörde spricht von einer „besorgniserregenden Entwicklung“. Zwar gebe es bei den jüngsten Vorfällen unterschiedliche Motive, doch die Intensität der Gewalt entwickle sich ins Extreme, sagt Nicolai Roth, Büroleiter von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). Der Senator setze sich dafür ein, „mit aller Konsequenz die Täter zu ermitteln“, sagte Roth.
„Wir haben es immer häufiger mit Gewalt zu tun, die nicht planbar ist“, sagt Jochen Kopelke, Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Bremen. „Wir haben oft Straftaten aus Gruppen heraus, oft im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen.“ Normale Polizeistreifen müssten heute damit rechnen, mit Gewalt konfrontiert zu werden. „Wir fordern, dass Angriffe auf Polizisten unter Strafe gestellt werden, da gibt es eine Gesetzeslücke“, kritisiert Kopelke. Häufig werde in Fällen wie dem Angriff auf einen Streifenwagen im Viertel nur wegen Sachbeschädigung ermittelt, aber nicht berücksichtigt, dass die Angriffe auf die Polizisten zielten.
„Die Polizei wird zerrieben zwischen verschiedenen Rollenerwartungen“, sagt Dietmar Heubrock, Professor für Rechtspsychologie an der Bremer Uni. Von den Beamten werde erwartet, politisch neutral und korrekt zu handeln und Täter festzusetzen. Heubrock, der zum Teil bei Gewalttaten gegen Polizisten als Fallanalyst hinzugezogen wird, spricht sich dafür aus, dass die Polizei massiver und offensiver auftreten solle. „Die Polizei setzt seit Jahren auf Deeskalation und hält sich im Hintergrund“, kritisiert er. „Das wird von einigen Bevölkerungsgruppen als Passivität und Hilflosigkeit wahrgenommen.“ Zudem würden sich immer mehr Menschen nicht mehr mit dem Staatssystem und seinen Vertretern identifizieren – ein Zeichen dafür sei auch die geringe Wahlbeteiligung.