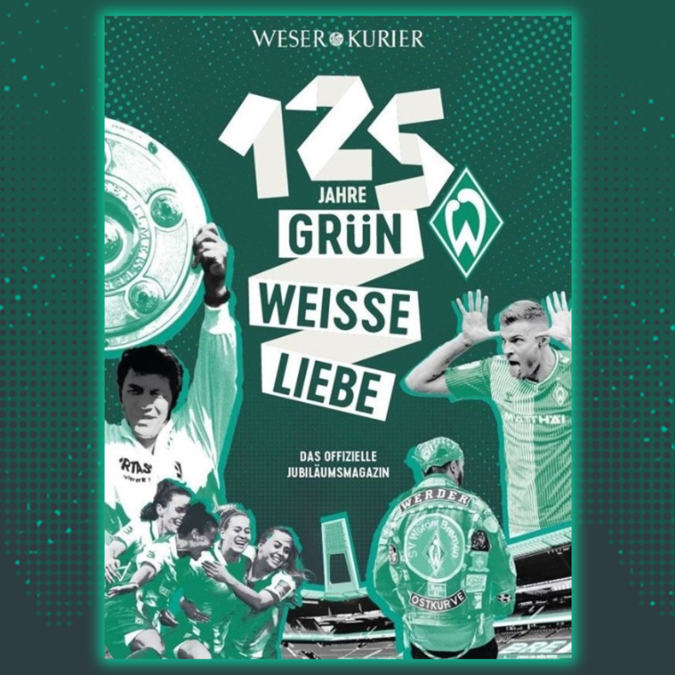In diesem Jahr ist das Klinikum Links der Weser ein halbes Jahrhundert alt geworden. Am 2. Januar 1968 nahm es die ersten Patienten auf. 50 Jahre später arbeiten insgesamt 1273 Beschäftigte im Klinikum Links der Weser. Wie stolz die jetzigen und früheren Beschäftigten auf das Krankenhaus und die Identifikation mit ihm sind, zeigt unsere Fotostrecke.
Jubiläum: 50 Jahre Klinikum Links der Weser Beschäftigte sind stolz auf ihr Krankenhaus
In diesem Jahr ist das Klinikum Links der Weser ein halbes Jahrhundert alt geworden. Wie stolz die jetzigen und früheren Beschäftigten auf das Krankenhaus und die Identifikation mit ihm sind, zeigt unsere Fotostrecke.
Karin Hackmann weiß: Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. In den Krankenhäusern ist die Verköstigung ein sehr wichtiger Faktor – und sorgt für entsprechend viel Gesprächsstoff. Karin Hackmann kennt den Küchen- und Cafeteria-Betrieb im Krankenhaus Links der Weser aus dem Effeff. Insgesamt 42 Jahre lang hat sie bis Mitte 2013 dort gearbeitet. „Es war eine schöne Zeit“, sagt die Rentnerin rückblickend. „Natürlich gab es mal Ärger, aber wir haben auch viel gelacht, das Betriebsklima war sehr gut und ebenso das Verhältnis der verschiedenen Berufsgruppen untereinander. Im Sommer 1971, dreieinhalb Jahre nach der Eröffnung des LDW, fing die gelernte Verkäuferin und junge Mutter als Helferin in der Küche in Teilzeit von 15.30 bis 20 Uhr an. „Damals wurde noch ganz viel selbst gemacht. Das Gemüse für das Mittagessen der einigen hundert Patienten und Krankenhausmitarbeiter wurde per Hand geputzt und zerkleinert“, erzählt Karin Hackmann.

Günter Wollborn war die erste männliche „Oberin“ im Land Bremen: Er übernahm bereits im Jahr 1969 Leitungsfunktionen im Pflegedienst des nahezu noch nagelneuen Zentralkrankenhauses Links der Weser. Eine Aufgabe, die zuvor bundesweit fast nur Frauen wahrgenommen hatten, die als Oberin bezeichnet wurden. „Ober“ konnte man das männliche Pendant schlecht nennen, denn diese Berufsbezeichnung ist bekanntlich in der Gastronomie üblich. Der gebürtige Bremer Günter Wollborn, der jetzt 85 Jahre alt ist und im Stadtteil Osterholz wohnt, wurde zunächst „Pflegevorsteher“, wenig später „erster Pflegevorsteher“ und 1990 Pflegedirektor und Mitglied des Krankenhaus-Direktoriums. Kaum hatte er den Dienst angetreten, musste er sich mit einer Personalkrise befassen. Gleich 17 Intensivpflegeschwestern drohten wegen Arbeitsüberlastung mit Kündigung. Die Misere war, dass kaum Fachkräfte auf dem Markt waren. Erst peu à peu verbesserte sich die Lage.

Andreas Callies gehört als Notarzt zum Team des ADAC-Rettungshubschraubers Christoph 6, der am LDW stationiert ist. 2017 gab es 1570 Einsätze für Christoph 6, also etwa vier pro Tag. 60 Prozent der Flüge des vergangenen Jahres waren im Bremer Stadtgebiet und 40 Prozent im Umland. Lange Zeit waren jährlich um die 1200 Einsätze gezählt worden, doch angesichts der älter werdenden Gesellschaft nahm die Anzahl weiter zu. Verkehrsunfälle sind übrigens nicht der häufigste Einsatzgrund. Unfälle aller Art – auch im Haushalt – stehen erst auf Platz zwei der Hubschrauber-Einsätze. Am häufigsten sind internistische Notfälle mit etwa 70 Prozent: Herzinfarkt, Schlaganfall, Asthma-Anfall und ähnliches. Dieser hohe Anteil liege daran, dass die Menschen immer älter werden, sagt Callies. Er arbeitet gern im Rettungsteam: „Alle Beteiligten der LDW-Hubschrauberstation sind eine super Truppe, die maximal motiviert sind und jeden Tag ihr Bestes zum Wohle der Patienten geben“, sagt Callies.

Ursula Doms arbeitete rund 40 Jahre bis 2007 in der Kinderklinik des Krankenhauses Links der Weser. Alles hatte mit einer Stellenanzeige im August 1968 im WESER-KURIER begonnen: Das erst im selben Jahr eröffnete Hospital suchte eine Kindergärtnerin für die Betreuung der jüngsten Patienten, und Ursula Doms bewarb sich erfolgreich. „Die Arbeit mit den Kindern hat mir über die vielen Jahre immer gut gefallen“, sagt Ursula Doms, die in Stuhr wohnt. Die Aufgabe ist ihr so sehr ans Herz gewachsen, dass sie sich auch als Rentnerin weiterhin regelmäßig für die kranken Kinder im LDW engagiert. Gemeinsam spielen oder basteln; jedes Wochenende kommen in Regie des Fördervereins der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin ehrenamtliche Helferinnen und Helfer ins Klinikum Links der Weser, um den kleinen Patienten Abwechslung zu bieten. „Wenn Kinder etwas tun können, was ihnen vertraut ist und was ihnen Spaß macht, trägt das zur Genesung bei“, ist Ursula Doms überzeugt.

Wilfried Bomhoff begann 1969 als Arbeiter im Hol- und Bringdienst im LDW, er war quasi Laufbursche im Krankenhaus. „Bomi“, wie er bald von den Kollegen genannt wurde, machte den Job gut, wurde 1979 als Angestellter übernommen und Ende 1982 zum Leiter des Zentrallagers berufen. Das blieb er bis zum Eintritt in den Ruhestand 2008. In den Jahren nach der Klinikeröffnung gab es im Lager nur drei Mitarbeiter. Weil die angesichts des ständig steigenden Arbeitsanfalls am Rotieren waren, wurde eine zusätzliche halbe Stelle für das Lager genehmigt, die 1969 Bomhoff zugewiesen wurde. Die andere halbe Stelle musste der gelernte Maler als Hilfskraft in der Küche verbringen. „Langeweile kam nie auf“, sagt der 74-Jährige, der in Martfeld wohnt. Heute gibt es im Krankenhaus selbst nur noch ein kleines Lager, während die meisten Artikel – 2200 verschiedene – in einem Zentrallager im Güterverkehrszentrum in Seehausen für alle vier städtischen Krankenhäuser vorrätig gehalten werden.

Jens Gronewold, der als junger Pfleger im Krankenhaus Links der Weser arbeitete und in Huchting wohnte, hatte Ende der 60er-Jahre noch keinen Telefonanschluss. Da war für die Oberschwester als seine Vorgesetzte Improvisieren angesagt, wenn wegen Personalnot mal wieder kurzfristig der Dienstplan umgeworfen werden musste. „Morgens um fünf Uhr klingelte an meiner Haustür die Polizei, um mir mitzuteilen, dass ich meinen Spätdienst vergessen könne und umgehend zum Dienst antreten müsse“, erzählt Gronewold. „Das kam bestimmt fünf bis sechs Mal vor.“ Dann hätten sich die Beamten des Polizeireviers Huchting aber geweigert, sich weiter zum Büttel der Oberschwester machen zu lassen. Fortan wurden Dienstplanänderungen per Telefon von Gronewolds Nachbarn durchgegeben. 1981 übernahm Jens Gronewold die Leitung der Intensivstation. Bekannt war „Groni“, wie er betriebsintern meist genannt wurde, für eine gute Stimmung und Nervenstärke.

Wolfgang Klausing musste vollkommen umdenken. Als Küchenchef eines renommierten Bremer Hotels hatte er für eine überschaubare Anzahl von Gästen leckere Gerichte und Buffets zubereitet. Doch dann wechselte er noch vor der Eröffnung zum neuen Krankenhaus Links der Weser und war viele Jahre dafür verantwortlich, dass die bis zu 650 Patienten satt wurden und es ihnen auch schmeckte. Klausing hatte Freude an seiner Aufgabe in der Großküche, der eine eigene Bäckerei und eine Schlachterei räumlich zugeordnet waren. Heute erinnert sich der 81-Jährige an seine 27-jährige Arbeit im Klinikum LDW sehr gerne zurück. „Mit der Präzision eines Uhrwerks war die Maschinerie des Krankenhauses angelaufen“, hieß es im WESER-KURIER über die Eröffnung im Januar 1968. Auch über das Geschehen in der Küche am Eröffnungstag wurde in dem Text berichtet: „Unter der Regie des Chefkochs bereiteten fleißige Köche das erste Mittagessen – Königsberger Klopse mit Kartoffeln."

Gerald Klose arbeitete 1987 bis zur Pensionierung 2010 als Chefarzt der Klinik für Innere Medizin im Krankenhaus Links der Weser und wirkte auch als langjähriger Ärztlicher Direktor. Der gebürtige Erfurter, der von der Universitätsklinik in Hamburg-Eppendorf nach Bremen kam, wohnt seit Langem in Schwachhausen und übt weiterhin in Bremen eine Praxistätigkeit als Arzt für Innere Medizin und Gastroenterologie aus. Die Kardiologie war und ist die Lebensader des LDW. Die rasante technische Entwicklung kam dem LDW zugute, dadurch wurde es auch wirtschaftlich attraktiv. Kloses Rolle als Ärztlicher Direktor glich der Arbeit eines Kapitäns: Ohne Teamarbeit und Vertrauen ist so ein "großer Tanker" nicht auf Kurs zu halten. Ja, die Identifikation der Beschäftigten mit dem Krankenhaus sei in allen Berufsgruppen sehr hoch gewesen, sagt Professor Klose heute. Viele seien auf "ihr" Krankenhaus stolz gewesen. Der Zusammenschluss der vier städtischen Kliniken könne dies gefährden.