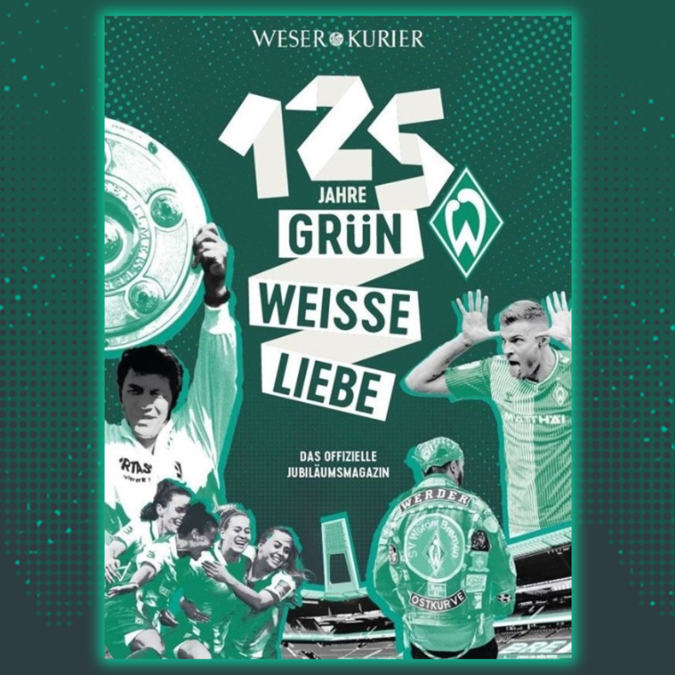Ein Jahr vor der nächsten Bürgerschaftwahl hat das Institut Infratest-dimap im Auftrag des WESER-KURIER Wahlberechtigte im Land Bremen, zu ihrer Zufriedenheit mit der Arbeit der Landesregierung befragt. Hier sehen Sie die Umfrageergebnisse und Bewertungen der Senatsmitglieder. Grün bedeutet sehr zufrieden, rot steht für weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden und grau bedeutet nicht bekannt oder nicht zu beurteilen.
Ein Jahr vor der Wahl Die Senatsmitglieder und ihre Bewertungen
Ein Jahr vor der nächsten Bürgerschaftwahl hat das Institut Infratest-dimap im Auftrag des WESER-KURIER Wahlberechtigte im Land Bremen zu ihrer Zufriedenheit mit der Arbeit der Landesregierung befragt. Sehen Sie hier die Ergebnisse.
Der Finanzfachmann
Ein gutes Drittel der Wähler findet Carsten Sieling okay, ein knappes Drittel nicht so doll, der Rest kennt ihn kaum oder sieht sich nicht zu einem Urteil in der Lage: Für den Ministerpräsidenten eines Bundeslandes ist ein solches Abschneiden in einer Umfrage höchst unbefriedigend. Schon 2016, als die Demoskopen von Infratest-Dimap erstmals die Zufriedenheit mit dem Bürgermeister erhoben, waren die Werte nicht berauschend. Damals gaben immerhin noch 42 Prozent der Befragten an, zufrieden oder sehr zufrieden mit der Arbeit des SPD-Politikers zu sein.
Wie kommen die schlechten Werte zustande? An Sielings Arbeitshaltung kann es nicht liegen. Der Mann ist fleißig und bescheiden, ein intelligenter Finanzfachmann, der wesentlichen Anteil daran hatte, dass Bremen ab 2020 deutlich mehr Geld aus Berlin bekommt.

Der Smarte
Eines hat Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) noch niemand abgesprochen: Der Mann kann sich gut verkaufen. Der 41-jährige Bremerhavener kommt bei öffentlichen Auftritten oder Unternehmensbesuchen meist souverän rüber, er weiß sich auf die Situation und sein Auditorium einzustellen. Und zuletzt hatte er auch die Zahlen der bremischen Wirtschaftsentwicklung auf seiner Seite: Mehr als drei Prozent Wachstum waren 2017 bundesweit Spitze.
Insider sehen Licht und Schatten in Günthners Behörde. Zwei Beispiele: Das Gründerangebot des Wirtschaftsressorts wird gerade neu aufgestellt. Zu unübersichtlich waren die bisherigen Strukturen, lautete die Kritik aus der Start-up-Szene. Das soll sich mit dem „Start-Haus“ ändern, unter dessen Dach die einschlägigen Angebote der Behörde in Kooperation mit der Bremer Aufbaubank gebündelt werden. Während auf diesem zunehmend wichtigen Feld der Wirtschaftsförderung etwas erkennbar vorankommt, bleibt völlig ungewiss, was aus dem Millionenprojekt Offshore-Terminal Bremerhaven wird. Dort ging kostbare Zeit verloren, in der wichtige Akteure der Windenergie aus der Seestadt abwanderten.
Dem Politikbetrieb schenkt Martin Günthner wenig Beachtung. Im Parlament glänzt er so häufig durch Abwesenheit wie keiner seiner Senatskollegen. Als beispielsweise die Opposition in der Bürgerschaft eine Aktuelle Stunde ansetzte, um über die Verlagerung der Produktion bei Hachez zu debattieren, schickte Günthner kurzfristig seinen Staatsrat Ekkehart Siering in die Bütt. Nicht zum ersten Mal.

Die Zugängliche
Von allen Senatoren verwaltet Anja Stahmann (Grüne) das meiste Geld. Im Jahr 2016 durchbrach das Sozialbudget innerhalb des Landeshaushaltes erstmals die Milliardengrenze, aktuell liegt es bei rund 1,1 Milliarden Euro. Den stetigen Aufwärtstrend bei den Sozialausgaben zu stoppen, ist noch keinem Ressortchef gelungen, auch Anja Stahmann nicht. Inzwischen liegen die Steigerungsraten allerdings nur noch auf dem Niveau vergleichbarer Großstädte, was man – ein wenig Bescheidenheit vorausgesetzt – auch schon als kleinen Erfolg betrachten kann.
Im Fokus der Öffentlichkeit stand die Sozialsenatorin vor allem 2015/16, als es galt, Tausende Flüchtlinge auf die Schnelle unterzubringen. Anja Stahmann warb damals auch in vielen Veranstaltungen auf Stadtteilebene um Verständnis. Sich bei solchen Themen kritischen Diskussionen zu entziehen, wäre nicht ihr Stil. Als eine Turnhalle nach der anderen zum provisorischen Massenquartier umgewandelt wurde, musste sich Stahmann von aufgebrachten Bürgern einiges anhören. Allerdings waren die Turnhallen später auch schneller wieder frei als in vielen anderen Kommunen. Kurz: Aufnahme und Verteilung der Flüchtlinge haben unter Stahmanns Leitung im Großen und Ganzen funktioniert.
Im Jahr 2015 übernahm die gebürtige Bremerhavenerin vom Innenressort die Zuständigkeit für den Sport. Stahmann gelang es, das Bäderkonzept des Senats zumindest so weit mit Geld zu unterfüttern, dass jetzt die Umgestaltung des Westbades und des Horner Bades in Angriff genommen werden können.

Die Geforderte
Als neues Gesicht kam Claudia Bogedan 2015 zum Senat: Nicht aus Bremen, sondern aus Bonn, nicht aus dem Politbetrieb, sondern aus der Wissenschaft und der Arbeit bei einer Stiftung. Die 43-Jährige übernahm das Zukunftsressort Kinder und Bildung, als bereits eine Talsohle erreicht war. Sie erbte einen Berg von Problemen: Fehlende Kita-Plätze, einen enormen Sanierungsstau an Schulen und die für Bremen fatalen Ergebnisse in den bundesweiten IQB-Bildungstests.
Die Lage zu verbessern und zugleich einen Behördenumbau zu stemmen, den Verwaltungsmitarbeiter teils blockierten – dieZusammenführung von Kita und Schule – diese Aufgabe wäre auch für einen ausgebufften Bremer Polit-Profi keine leichte.
Bogedan ist angenehm im Umgang und macht im Gespräch mit Schulbeschäftigten und Eltern meist einen guten Eindruck: Sie hört zu und hat soziale Unwuchten im Blick. Doch bei der Durchsetzung ihrer Ziele hakte es oft, auch Kommunikationspannen häuften sich zuletzt. Teils scheiterte sie mit Plänen an politischen Fallstricken und hatte in ihrer Behörde nicht immer die nötige Unterstützung.
Fachlich habe sie sich gut eingearbeitet, bestätigen Vertreter aus Opposition und Regierung. Als politische Strategin fiel sie aber bislang nicht auf, sie wirke teils gehetzt und habe wenig eigene Themen gesetzt, monieren Oppositionspolitiker.
Unter Bogedans Führung hat Bremen ein Kita-Ausbauprogramm in Containern gestemmt. Darauf ist man im Senat stolz. Dabei ist klar: Das ist erst der Anfang, Kitas und Schulen müssen weiter wachsen. Bogedan bleibt extrem gefordert.

Die Unnachgiebige
Mission erfüllt: Dieses Zeugnis wird Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) am Ende der Legislaturperiode entgegennehmen können. Seit 2011 hatte Linnert im Rahmen eines mit der Bundesregierung ausgehandelten Konsolidierungsprozesses dem Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes entgegengespart, und das hat geklappt. Mit dem Doppelhaushalt 2018/19 ist die letzte Etappe der Defizitreduzierung geschafft. Dass sprudelnde Steuerquellen und ein historisch niedriges Zinsniveau dabei halfen – oder genauer: diesen Erfolg erst möglich machten – , darüber redet in ein paar Jahren niemand mehr. Es wird Karoline Linnert sein, mit deren Namen sich der Weg aus dem Schuldenstaat verbindet.
Ohne Ellenbogen und Durchsetzungsvermögen würde man auf einem solchen Weg straucheln, doch mit diesen Gaben ist Karoline Linnert reichlich gesegnet. Das haben die Fachsenatoren beider Regierungsparteien häufig erfahren dürfen. Auch bei den Grünen sagt Karoline Linnert hinter den Kulissen immer noch, wo's langgeht. Das hat sich erst kürzlich wieder gezeigt, als die 59-Jährige ihren Anspruch auf die Spitzenkandidatur bei der Bürgerschaftswahl 2019 rigoros durchsetzte. Obwohl die Linnertsche Haushaltsdisziplin mit den Ausgabenwünschen der Linken eigentlich unvereinbar ist, scheinen dieGrünen bei der Wahl im kommenden Jahr auf ein rot-rot-grünes Bündnis zuzusteuern. Auffallend deutlich ließ Linnert kürzlich anklingen, sie habe keine Berührungsängste mit den Linken. Für "Jamaika"-Avancen von CDU und FDP scheint sie nicht empfänglich zu sein. Derzeit wenigstens.

Der Beharrliche
Die Beharrlichkeit, mit der Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) seine Ziele verfolgt, selbst wenn er damit allein auf weiter Flur steht, nötigt selbst seinen politischen Gegnern Respekt ab (wobei der eine oder andere allerdings eher von „Sturheit“ oder „Dickfelligkeit“ spricht). Egal, ob es um den Streit mit der Deutschen Fußball-Liga geht, um die Abschiebung von Salafisten oder die Überarbeitung des Polizeigesetzes. Mäurer bezieht Stellung, riskiert etwas und lehnt sich zuweilen weit aus dem Fenster. Wohl wissend, wie tief man dabei als Politiker fallen kann.
Beim Bürger scheint das anzukommen. Zwar blieb Mäurers Wert in der Zufriedenheitsskala unverändert. Doch damit liegt er im Ranking derPolitiker nach Bürgermeister Sieling auf dem zweiten Platz. Und unzufrieden mit seiner Amtsführung ist nur jeder Vierte der Befragten. Ein Wert, von dem die meisten seiner Senatorenkollegen nur träumen können.
Mäurer gilt als durchsetzungsfähig, auch gegenüber seiner eigenen Partei und erst recht gegenüber dem grünen Koalitionspartner. Dass er sich damit nicht nur Freunde macht, liegt auf der Hand. Andererseits hat er sich damit den Ruf erarbeitet, nicht zu sehr nach parteipolitischen Ideologien zu handeln. Auch davon können andere Bremer Senatoren nur träumen.
Doch auch Mäurer stößt zuweilen an Grenzen, wie zuletzt beim neuen Polizeigesetz. Und dass die Umsetzung seiner Polizeireform nach wie vor nicht wirklich voran kommt, könnte auf einen Mangel an strategischer Vorplanung zurückzuführen sein. Wenn man so will, die Kehrseite des entschlossenen Auftretens als Macher.

Der Befreite
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr – schon die Amtsbezeichnung macht deutlich, dass auf diesem Posten vor allem die Fähigkeit zum Ausgleich gefragt ist. Der Schutz der Natur, die Bereitstellung eines leistungsfähigen Straßennetzes und die Stadtentwicklung sind Aufgaben, die ständig neu austariert werden müssen. Die Moderation widerstreitender Interessen ist Alltag des Ressortchefs. Das hat Joachim Lohse mal besser, mal schlechter hinbekommen. Manchmal scheint ihm – dem Chemiker, der mit nur minimaler Erfahrung im Politikbetrieb ins Senatorenamt kam – ein wenig das Gespür dafür zu fehlen, wie viel Ärger man sich mit Entscheidungen einhandeln kann, die sich aus dem logischen Blickwinkel des Wissenschaftlers ganz einfach darstellen: DerDeich am Neustädter Weserufer muss erhöht werden? Dann werden halt 136 Bäume gefällt, die kann man schließlich nachpflanzen. Dass Politik so nicht funktioniert, hat Joachim Lohse gelegentlich schmerzhaft erfahren müssen.
Auch von Seiten der Wirtschaft ist er immer wieder unter Beschuss geraten, etwa wegen zu langer Genehmigungszeiten für Schwertransporte oder maroder Verkehrsinfrastruktur am Logistikstandort Bremen. Zuletzt hat Lohse wieder etwas stärker versucht, das grüne Profil seines Ressorts hervortreten zu lassen, zum Beispiel durch eine ökologischere Ausrichtung des Bau- und Planungsrechts. Das Vorzeigeprojekt zusätzlicher Fahrradbrücken über die Weser ist allerdings in der Warteschleife. 2019 tritt Lohse nicht mehr an. Von dieser Entscheidung erhofft er sich für das verbleibende Jahr mehr „Beinfreiheit“. Ob die sich einstellt, wird sich zeigen.

Die Aufseherin
Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz – ein ziemlicher Gemischtwarenladen, dem Eva Quante-Brandt vorsteht. Wirklich heimisch ist sie in der Wissenschaft. Die habilitierte Pädagogin lehrte für einige Jahre an der Bremer Uni, bevor sie 2011 als Staatsrätin in die erweiterte Regierungsmannschaft aufrückte. Als nach der Wahl 2015 die Senatsressorts neu zugeschnitten wurden, musste Quante-Brandt den Bildungsbereich an ihre Parteifreundin Claudia Bogedan abgeben und nolens volens den Gesundheitssektor übernehmen.
Dort gibt es aktuell auch die größten Probleme. Der städtische Klinikverbund Gesundheit Nord kommt nicht aus den roten Zahlen. Das ohnehin schon ärgerlich hohe Defizit von 12,6 Millionen Euro aus dem vergangenen Jahr erhöhte sich nach Bekanntgabe Anfang Februar innerhalb von zwei Wochen um weitere sechs Millionen Euro. Nach außen vermittelte sich dadurch der Eindruck, dass Quante-Brandt – diezugleich dem Aufsichtsrat der Gesundheit Nord vorsteht – die Kontrolle über den Kliniksektor zunehmend entgleitet. Zuletzt machte dieSenatorin durch ihren Führungsstil von sich reden.
Weniger konfliktträchtig stellt sich der Wissenschaftsbereich dar. Im zuständigen Bürgerschaftsausschuss wird vergleichsweise oft an einem Strang gezogen, was auch mit Themen wie der Wiedererlangung des Exzellenzstatus für die Bremer Uni zu tun hat. Aktuell wird in Quante-Brandts Behörde am Wissenschaftsplan 2025 gearbeitet. Er soll eine Antwort darauf geben, wie die Hochschulen des kleinsten Bundeslandes zukunftsträchtig aufgestellt werden können.