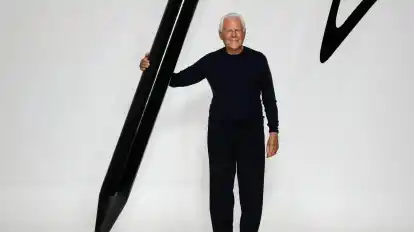Herr Amara, Sie spielen mit Ihrer Band mittlerweile in den größten Hallen des Landes, in Bremen in der ÖVB-Arena. Muss man sich da manchmal kneifen, um zu begreifen, wo man angekommen ist?
Sammy Amara: Ja, das ist wichtig, damit man nicht vollkommen am Rad dreht. Zum einen sind diese kleinen Schritte, die wir immer gemacht haben, Garant dafür, dass wir nicht durchdrehen. Es ging immer nach oben, aber eben sehr langsam. Zum anderen helfen da unsere Wurzeln im Punkrock. Wir sind immer noch in Deutschland, da ist die Haltung: Erfolg ist nichts Gutes.
Wie sehr verändern die Größenverhältnisse der Hallen die Shows?
Idealerweise gar nicht. Mit Showeffekten fremdeln wir eher. Ich würde beispielsweise auch nie Ansagen proben wollen. Das würde vielleicht keiner merken, wenn ich das täte, aber für uns würde sich das komisch anfühlen. Das wäre würdelos. Wir proben unser Set, so gut es geht. Wenn man sich da sicher ist, kann man variieren und ist entspannter. Und wir versuchen, das Gefühl einer kleinen Bühne auf eine große zu bringen. Wir müssen das selber genießen können, dann können wir es auch nach außen transportieren.
Gibt es bei den ganz großen Konzerten Freiräume im Set?
Das Gerüst steht fest, aber wenn man Lust darauf hat, dann nimmt natürlich auch mal einen anderen Song mit ins Programm. Erstaunlicherweise sitzen die alten Sachen auch nach 23 Jahren Bandgeschichte noch, das ist fest abgespeichert in meinem kleinen, hässlichen Kämmerlein... Und dann passieren natürlich immer wieder unvorhergesehen Dinge, wenn zum Beispiel der Sänger den Text vergisst.
Schaffen es auch andere Titel spontan auf die Setlist?
Wir covern gerne, aber es gibt gewisse Hits, das wäre frech, die nicht zu spielen. Die Leute zahlen viel Geld, um uns zu sehen; gewisse Sachen wünsche die sich einfach. Wir haben etwas bei einer Bruce Springsteen-Show gelernt: Als er anfing mit „The River“ habe mich total gefreut. Dann hat er das in so einer beschissenen Blues-Version gespielt und ich war so sauer, dass ich mir geschworen habe, wir machen keine verrückten Versionen von unseren Liedern. Wir spielen die so, wie die Leute sie lieben.
Sie sagten, die Broilers sind sehr langsam gewachsen. Gab es irgendwann in dieser Entwicklung den Punkt, a dem klar war: Jetzt haben wir es geschafft?
1996, als wir mit 15, 16 Jahren die erste Single veröffentlicht hatten, da haben wir gedacht: So, jetzt haben wir alles erreicht. Das war so ein Moment, wo wir das wirklich geglaubt haben. Aber ernsthaft irgendwann zu meinen: Jetzt sind wir über'n Berg, jetzt läuft das ganze Ding von alleine – nein. Wir haben eine imaginäre Streichliste, da stehen Ziele drauf. Die verraten wir aber keinem. Wenn wir ein Häkchen mehr dran machen können, freuen wir uns. Ein Meilenstein war zum Beispiel, in der Philipshalle in Düsseldorf zu spielen. An der sind wir als Kinder mit der S-Bahn vorbeigefahren.
Wenn man in den größten Hallen spielt, das Album auf Platz eins in den Charts steht – was soll da noch kommen?
Ich bin immer wieder gespannt aufs nächste Album. Ich freue mich jetzt schon auf den Nachfolger von „sic!“, weil ich selber wissen will, wie das wohl klingen wird. Ich freue mich aufs Songwriting, darauf, gemeinsam rumzuhängen und neue Erfahrungen zu machen. Es geht für mich nicht darum, dass ich dieses oder jenes auch noch abgrase; ich will die Momente mitnehmen.
Das Interview führte Lars Fischer.