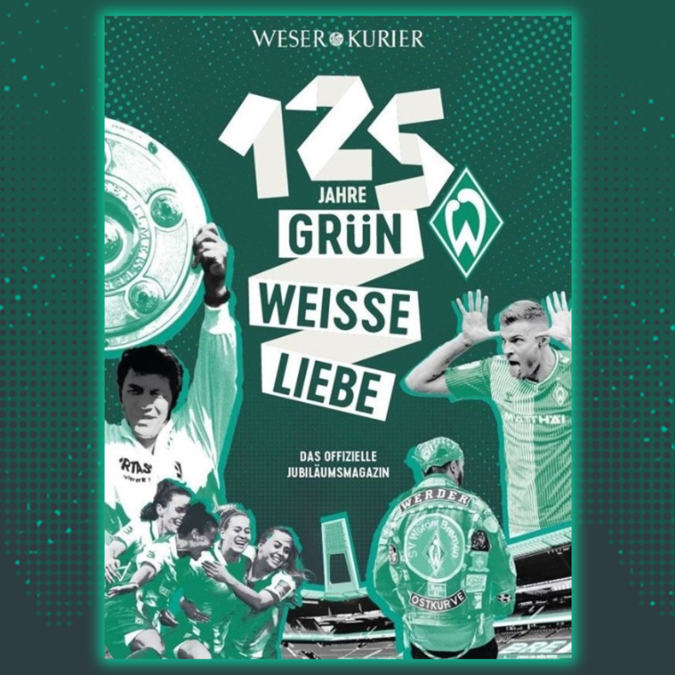Quo vadis, Europa? Die Europäer haben gewählt. Mit dem Ergebnis und dessen Bedeutung setzen sich Zeitungen weltweit am Montag auseinander. Hier einige Pressestimmen.
Kommentare Internationale Pressestimmen zur Europawahl
Quo vadis, Europa? Die Europäer haben gewählt. Mit dem Ergebnis und dessen Bedeutung setzen sich Zeitungen weltweit am Montag auseinander. Hier einige Pressestimmen.
Die Europawahl kommentiert die spanische Zeitung "El Mundo" am Montag:
"Schreck oder Tod war angesichts der starken populistischen Welle, die den Kontinent durchzieht, die Alternative, die sich vor den entscheidenden Wahlen zum Europäischen Parlament aufgetan hatte. Letztendlich hat die Abstimmung den Alarm stark abgemildert, da der Vormarsch der europhoben Parteien geringer ausfiel als erwartet. (...)
Dennoch sind der Sieg der extremen Rechten von Marine Le Pen in Frankreich, das großartige Ergebnis von (Matteo) Salvini in Italien oder die Tatsache, dass sich die Brexit-Partei von Nigel Farage in Großbritannien durchgesetzt hat, ernsthafte Warnungen: Die Anführer der Union müssen nun ihre Führungsrolle unter Beweis stellen und endlich das Steuer eines Schiffes in die Hand nehmen, das schon viel zu lange nicht mehr auf Kurs ist." (dpa)

Zum Sieg der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz bei der Europawahl in Ungarn schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung "Magyar Nemzet" in einem Kommentar am Montag:
"(Bundeskanzlerin Angela) Merkel und (der französische Präsident Emmanuel) Macron erhielten ein dickes Nein. Jenseits des Ärmelkanals und aller Vernunft siegten - als neuerliche Perle des britischen Humors - (Nigel) Farage und seine Brexit-Partei.
Das zehn Millionen Einwohner starke Ungarn kann naturgemäß nicht jedes Dilemma, jede Sorge des gesamten europäischen Kontinents mit seiner halben Milliarde EU-Bürgern schultern. Unsere (ost-mitteleuropäische) Region erfährt aber eine zunehmende Aufwertung und kann nicht zum ersten Mal in der Geschichte dem Westen ein Beispiel geben. Im Europa des 14. Jahrhunderts, das maurische Kriegszüge, der 100-jährige Krieg, die Avignoner Gefangenschaft der Päpste und die inneren Konflikten des Römischen Reichs Deutscher Nation erschütterten, war es (der ungarische König) Karl Robert, der beim Visegrader Königstreffen im Jahr 1335 durch den Friedensschluss mit dem tschechischen König Johann und dem polnischen Herrscher Kasimir dem Großen (...) eine ihrer Zeit weit vorauseilende politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit auf den Weg brachte." (dpa)

Die liberale schwedische Tageszeitung "Dagens Nyheter" (Stockholm) kommentiert am Montag das Ergebnis der Europawahl:
"Nicht nur die Rechtspopulisten legen zu, sondern auch liberale und grüne Parteien. Ein politisches Erdbeben ist das jedoch nicht. Dass EVP und S&D ihre Mehrheit verlieren, beinhaltet in der Praxis, dass die liberalen und in gewisser Weise auch die grünen Parlamentsgruppen mehr Einfluss erhalten. Darüber sollte man sich nicht beklagen. Gleichzeitig kommen die Rechtspopulisten vielerorts voran.
Zusammen fällt Parteien wie der italienischen Lega und den schwedischen Schwedendemokraten wohl ein Viertel der Mandate zu. Aber das ist keine Mehrheitsbewegung. Schaffen es die europafreundlichen Kräfte in der breiten Mitte, Kompromisse zu finden, dann wird es auch nach dieser Wahl möglich sein, die Arbeit im EU-Parlament auf konstruktive Weise fortzuführen." (dpa)

Zum Kampf um die Nachfolge von Theresa May meint der Londoner "Independent" am Montag:
"Die Realität sieht natürlich so aus, dass es der EU egal ist, wer britischer Premierminister wird. Sie wird das Abkommen nicht neu verhandeln. Sie wissen wie alle anderen und auch wie die Bewerber auf den Job des Parteichefs, dass die Drohung eines EU-Austritts ohne Abkommen ein Bluff ist. Dafür gibt es bislang und wird es wahrscheinlich nie eine Mehrheit im Unterhaus geben.(...)
Es wird für die Brexiteers keine Zeit zu Neuverhandlungen bis zum 31. Oktober geben, ohne eine weitere Verlängerung von Artikel 50, die dann möglicherweise an Bedingungen geknüpft ist. Das Chaos wird so schlimm wie eh und je sein.
Wer immer die Flitterkrone gewinnt, wird seine Zeit als Premierminister unter Tränen beenden. Er wird genauso sicher scheitern wie Cameron und May. Und zwar aus den gleichen fundamentalen Gründen. Die 47 Millionen britischen Wähler sind die Richtigen, das Problem zu lösen, und nicht die 124.000 Mitglieder der Tory-Partei." (dpa)

Zur Bedeutung der Europawahl für die italienische Regierung aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung schreibt die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Montag:
"Seit Monaten gibt es (...) zwei Regierungen: Es wird schwierig, jetzt dazu zurückzukehren, eine zu sein. Die Allianz zwischen Fünf-Sterne-Bewegung und Lega, die politisch bereits aus dem Gleichgewicht ist, ist nun auch zahlenmäßig umgeworfen. Für eine Regierung, die aus Parteien zusammengesetzt ist, die keine gemeinsame Perspektive haben, wird es kompliziert, ein neues Gleichgewicht zu finden. Der Erfolg für (Lega-Chef Metteo) Salvini bei der Europawahl wird der Auftakt eines Wettbewerbs auf allen Feldern mit den Fünf Sternen sein. (...) Das Ziel der Lega wird die Übernahme der Koalition sein." (dpa)

Zur Europawahl 2019 schreibt am Montag die bulgarische Zeitung "24 Tschassa":
"Bei den Wahlen zum EU-Parlament zeichnet sich ein klarer Trend ab: Die Konservativen verlieren Mandate, Populisten und Linke gewinnen mehr Plätze. (.) Die deutschen Sozialdemokraten erlitten einen schweren Schlag. Einen ernsthaften Stimmenverlust gibt es auch bei den Christdemokraten.
Beide Parteien verzeichnen einen enormen Wählerverlust im Vergleich zur vorausgegangenen Europawahl. (.) Bei dieser EU-Wahl gab es allerdings eine sehr hohe Wahlbeteiligung. In den meisten EU-Mitgliedstaaten gingen beachtlich mehr Menschen zu den Wahlurnen als bei früheren Europawahlen." (dpa)

Die linksliberale polnische Zeitung "Gazeta Wyborcza" schreibt am Montag zur Europawahl:
"Die Europäer lähmt seit längerer Zeit die Angst um ihre Zukunft. (...). Selbst dort, wo Frieden das Selbstverständlichste ist, fürchten sie Studien zufolge Instabilität und Kriege. Vielleicht können die Populisten deswegen nicht von einem Erfolg sprechen. Die Vision, dass sie Europa übernehmen, ist entrückt. Die Verteidiger eines vereinten Europas haben der EU fünf Jahre Zeit gekauft.
In dieser Zeit müssen sie die Ängste der Europäer besänftigen, sich um den Schutz der europäischen Grenzen kümmern und auf gesellschaftliche Veränderungen eingehen. Europa muss imstande sein, die eigene Zukunft zu erschaffen, und nicht dabei zusehen, wie außerhalb seiner Grenzen über seine Zukunft entschieden wird. Fünf Jahre sind viel Zeit, um die EU nach vorne zu bringen. Wenn die Politiker sie vergeuden, wird ihnen niemand mehr (Wahl-) Slogans zu den Folgen, die ein Fall Europa hätte, abkaufen." (dpa)

Das starke Abschneiden der Partei der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen bei der Europawahl kommentiert "La Charente libre" am Montag:
"Dieses Ergebnis zwingt (Präsident) Emmanuel Macron schließlich nicht nur dazu, seine Ansprachen grüner zu gestalten, sondern auch dazu, Maßnahmen zu ergreifen. Dabei darf die liberale Alternative aber nicht die einzige Antwort auf den Nationalismus sein (...). Es ist nun ein Kampf endlich klarer Werte, den der Kontinent gerade austrägt. Einer, der euch zwingt, Partei zu ergreifen und den Weg zu ändern. In dieser Hinsicht ist es eine gute Nachricht, denn Europa geht heute langsam aus den gleichen Gründen zugrunde, aus denen es gestern niedergemetzelt wurde: Gleichgültigkeit gegenüber der Zunahme der Gefahren." (dpa)

Zum Abschneiden des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei der Europawahl heißt es am Montag in der Amsterdamer Zeitung "de Volkskrant"(Online-Ausgabe):
"Ein Schlag gegen das proeuropäische Lager ist die Niederlage des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Er präsentierte sich als Fahnenträger im Kampf gegen Nationalismus und Populismus. Macron gegen (Matteo) Salvini (und seine rechte Lega in Italien), aber er wird von (der Rechtspopulistin Marine) Le Pen besiegt. Die vom französischen Präsidenten so stark propagierte "Wiedergeburt" Europas scheint in seinem eigenen Land die schwierigste Geburt zu werden. Das, was von Macron als nationalistisches Gespenst betrachtet wird, ist noch lange nicht besiegt. Schon allein deshalb, weil Gegner Salvini der große Gewinner in Italien ist, einem anderen großen EU-Land." (dpa)

Zur Europawahl heißt es am Montag in der belgischen Zeitung "De Morgen" (Online-Ausgabe):
"Die Euroskeptiker werden immer stärker, aber der große Handstreich bleibt aus. Hier und da wurde erwartet, dass eine Welle von populistischen und euroskeptischen Parteien das Europäische Parlament überfluten würde. Mit Matteo Salvini und Marine Le Pen haben einige Anführer ihre nationalen Wahlen gewonnen, aber das scheint nicht auszureichen, um das Kräfteverhältnis im Europäischen Parlament ordentlich durcheinanderzubringen." (dpa)

Die US-Tageszeitung "New York Times" schreibt am Sonntag zur Europawahl:
"Alles in allem weisen die Ergebnisse darauf hin, dass sich der Kampf um die künftige Richtung der Gemeinschaft - ein stärkeres Zusammenrücken unter europäischen Ländern oder ein geringeres - intensivieren wird. Es ist davon auszugehen, dass die Populisten und Nationalisten mit mehr als einer Stimme im Parlament versuchen werden, bei Fragen wie der Beschränkung von Einwanderung oder Haushalt noch mehr Druck auszuüben. Wahrscheinlich werden sie versuchen die Pläne der Pro-Europäer zu blockieren, und auf mehr Macht für die Staaten dringen als für die Bürokratie, die sie für elitär halten.
Trotzdem sind die EU-gegnerischen Kräfte weiterhin verschieden und uneinig und könnten es schwer haben, ernsthaft Macht auszuüben. Die größten Auswirkungen werden wohl viel mehr genau dort zu spüren sein, wo es den Rechtsaußen- und Populisten-Führern am liebsten ist: in ihren Heimatländern, vor allem in Frankreich und Italien, wo sie damit drohen, das traditionelle Parteiensysteme weiter zu stören und Macht zu erringen. Seit Monaten haben sie diese Wahlen als Lackmustest ihrer Beliebtheit beworben." (dpa)

Zur Europawahl schreibt am Montag die "Neue Zürcher Zeitung"(Online-Ausgabe):
"Bei der Europawahl haben die proeuropäischen Kräfte am Sonntag den großen Angriff der Rechtsnationalen abgewehrt, doch dürfte sich das neu gewählte Europaparlament in der Legislaturperiode zwischen 2019 und 2024 wesentlich zersplitterter präsentieren als das bisherige. (...) Ein Treffen zwischen den Spitzenkandidaten am Montagabend sowie eine Sitzung der Fraktionschef am Dienstag sollen nun einen Weg aus der verfahrenen Lage weisen, wobei das Europaparlament unter Druck steht, sich rasch auf einen gemeinsamen Kandidaten fürs Kommissions-Präsidium zu einigen.
Denn bereits am Dienstagabend kommen in Brüssel die Staats- und Regierungschefs der 28 EU-Staaten zusammen, die eine Blockade im Parlament ausnützen und neue Kandidaten ins Spiel bringen könnten. Das Ringen droht also zum Machtkampf zwischen dem Parlament und den Mitgliedstaaten zu werden." (dpa)

Nach dem starken Abschneiden der Partei der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen bei der Europawahl und den Konsequenzen für Staatschef Emmanuel Macron schreibt die französische Tageszeitung "Le Figaro" am Montag:
"Für Marine Le Pen ist es ein symbolischer Sieg (...), der vor allem ihre erniedrigende Niederlage gegen Emmanuel Macron vor zwei Jahren ausgleicht.
Für Staatschef (Macron) ist das Wichtige aber woanders. Die vom ihm vorhergesagte, gewollte und organisierte politische Neuaufstellung hat einen (...) entscheidenden Erfolg verzeichnet.(...) Zwischen Macron und Marine Le Pen gibt es nichts mehr (...)." (dpa)

Das starke Abschneiden der Partei der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen bei der Europawahl kommentiert die katholische Tageszeitung "La Croix" (Paris) am Montag:
"Dieses Ergebnis führt nicht zu einer institutionellen Krise in Frankreich. Bei der Europawahl 2014 lag die Liste der extremen Rechten bereits an der Spitze, ohne wirklich die Gesamtlage zu ändern.
Die Ergebnisse sind jedoch ein ernsthafter Rückschlag für Emmanuel Macron. Der Staatschef, der einen jeglichen Kurswechsel ausgeschlossen hat, muss die geplanten Baustellen wie die Arbeitslosenversicherung und die Renten in einem neuen Licht erscheinen lassen." (dpa)

Die US-Zeitung "Washington Post" schreibt am Sonntag (Ortszeit) zur Europawahl:
"Der größte Quell des Zuspruchs für Rechtsaußen schien Italien zu sein, wo die Lega-Partei des Innenministers Matteo Salvini auf den ersten Platz sprang, und das nach einem Jahr, in dem er mit der Abschiebung von Migranten und einer Schwächung der EU im ganzen Land eine scharfe Wahlkampagne geführt hatte. Aber sein Plan für einen europaweiten Durchmarsch europaskeptischer Verbündeter muss nun etwas zurückgefahren werden. Viele seiner potenziellen Partner heimsten nur kleine Wahlgewinne ein, wenn überhaupt. Es wurde nie erwartet, dass sie eine Mehrheit im Parlament bekommen könnten, jetzt ist es unwahrscheinlich, dass sie stark genug sind, um eine blockierende Minderheit zu sein.
Stattdessen könnten die Grünen und andere Pro-Umweltgruppen und sozial-liberale Parteien die Überraschung der Wahl sein, nachdem sie in Frankreich, Deutschland, Finnland und anderen Ländern an zweite oder dritte Stelle rutschten. Das Ergebnis ist ein Europäisches Parlament, in dem die Parteien der Mitte erstmals daran scheiterten, eine Mehrheit zusammenzubekommen, und sich nun die Unterstützung von Abgeordneten holen müssen, die eine weniger orthodoxe Sicht davon haben, wie Europa zu steuern ist." (dpa)

Die Londoner "Financial Times" schreibt am Montag in ihrer Online-Ausgabe zur Europawahl:
"Die Wahlergebnisse in den 28 EU-Mitgliedsstaaten werden einen entscheidenden Einfluss auf die politische Ausrichtung in Brüssel für die kommenden fünf Jahre haben. Sie legen die Haltung des Parlaments zu so sensiblen Themen wie grünen Steuern und internationalen Handelsabkommen fest. Und sie wiegen auch schwer beim Wettlauf um die EU-Top-Jobs.
Wenn sich die vorläufigen Ergebnisse bestätigen, würde dies das Ende der Mitte-Links- und Mitte-Rechts-Mehrheit bedeuten, die seit 1979 im Parlament herrscht und einem gespalteneren Pro-EU-Block weichen, der bis zu vier Parteien umfassen wird." (dpa)