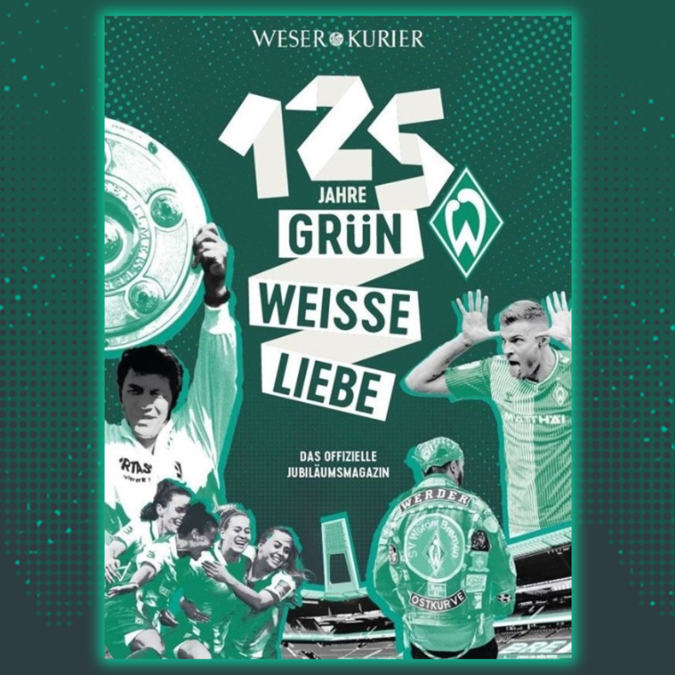Stroh im Kopf, strohdumm, Strohwitwer – mit den getrockneten Getreidehalmen sind überwiegend negative Redewendungen verknüpft. In Twistringen hängt Stroh und das damit verbundene Handwerk eng mit der Stadtgeschichte zusammen, denn Twistringen galt viele Jahre als Hochburg der Strohindustrie in Deutschland. Um das Jahr 1830 herum gab es bis zu 50 Strohhutmacher im Ort. Heute erzählt das einzigartige Strohmuseum die Geschichte dieses traditionsreichen Handwerks und möchte den Blick auf das Stroh zum Positiven verändern.
Regelmäßig rattert die historische Strohhut-Nähmaschine im Museum der Strohverarbeitung, wenn die Frauen der Nähstube aus Strohgeflecht modische Hüte voll handwerklicher Präzision fertigen. Schneckenförmig entsteht mit geübten Handgriffen zunächst ein Rohling, der an Holzmodellen angepasst wird und schließlich in der Hutpresse seine finalen Konturen erhält. „Um 1900 ging niemand ohne Strohhut aus dem Haus“, berichtet Helmut Beneke. Der ehrenamtliche Museumsführer ist einer von 40 Engagierten, die in verschiedenen Teams – von Gästeführern über die Nähstube bis zu Service und Instandsetzung – das Museum am Laufen halten.
Karl-Heinz „Carlo“ Schütte, der seit gut einem halben Jahr den Vorsitz des Vereins innehat, erinnert sich, wie seine Großeltern in der heimischen Küche Strohhalme schnitten, um sich ein Zubrot zu verdienen. Im Strohmuseum gibt es eine Nachbildung einer solchen Küche und viele der älteren Besucher schwelgen bei Führungen regelmäßig in Kindheitserinnerungen.
Im Museum ist alles echt, es gibt keine Reproduktionen. Auch die Malottenmaschine, mit der Strohhülsen produziert werden, ist ein Original. In den 1930er-Jahren exportierte Twistringen bis zu einer halben Million solcher Flaschenummantelungen pro Jahr bis nach Amerika – ein Beweis für das weltweite Ansehen dieses Handwerks. Der Spruch „Unser Stroh in alle Welt“ prägte jene Zeit. Der Ausdruck Malotte geht dabei auf die Twistringer Mundart zurück.
Ungeachtet der Skepsis, die 1990 die Idee für ein Museum begleitete, setzten der Heimat- und Bürgerverein sowie der neu gegründete Förderverein ihren Plan in die Tat um: Aus einer alten Scheune wurde in mehreren Bauphasen zwischen 1992 und 1998 das heutige Strohmuseum. „Mit dem Erfolg hatte wohl niemand gerechnet“, freut sich Beneke noch heute. Von März bis November können Besucher das Strohmuseum entdecken – und einen Blick auf den größten Strohhut der Welt werfen: 500 Kilogramm schwer mit einem Durchmesser von 5,5 Metern. Dieser entstand anlässlich der 750-Jahr-Feier der Stadt und sicherte ihr einen Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde. Der überdimensionale Hut ist ein stolzer Beleg dafür, dass Stroh in Twistringen weit mehr ist als ein Halmmaterial.

Gespannt verfolgt diese Besuchergruppe aus Bremen, wie ein Strohhut entsteht.