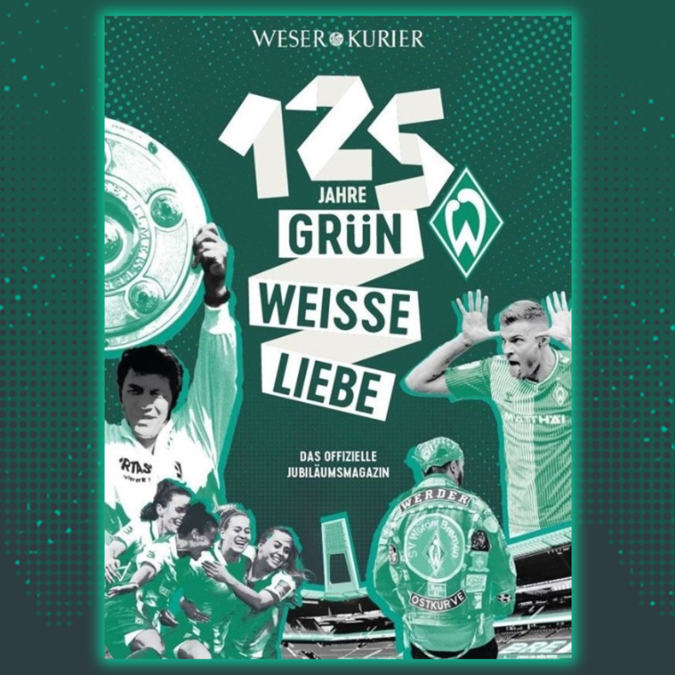Frau Ahrndt, die Eröffnung der neuen Ozeanien-Ausstellung musste von Oktober 2024 auf Ende März 2025 verschoben werden. Inwieweit hat Sie das aus dem Tritt gebracht?
Wiebke Ahrndt: Im Herbst zu eröffnen, wäre netter gewesen, aber die Situation, was die Bauarbeiten, das Material und die Fachkräfte angeht, ist im Moment nun mal schwierig. Was das Konzept angeht, hat uns das nicht verunsichert.
Sie hätten die Zeit gehabt, noch mal nachzuschärfen oder auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren.
Das müssen wir nicht. Die Ausstellung ist auf mehrere Jahre angelegt. Wir hätten etwas falsch gemacht, wenn wir damit kalkulieren müssten, dass da schon etwas überholt sein könnte. Im Moment sind wir mit den Modellbauern im Gespräch, das ist eine ganz hinreißende Firma. Die produzieren unsere Südsee-Insel in England, zerlegen sie und bauen sie hier wieder auf. Die Firma hat schon die Kulissen zu den "Harry Potter"-Filmen gebaut und die Figuren von "Wallace & Gromit". Es soll auch Felsen geben bei uns, und dann kommt schon mal die Antwort: "Wir schicken Ihnen mal einen, den haben wir noch von Hogwarts übrig."Das ist natürlich toll.
Ihr Ansatz für die neue Ausstellung lautete von Anfang an: Wir beziehen die Herkunftsgesellschaften ein. Auf einmal liegen Sie damit voll im Trend; das machen jetzt landauf, landab alle Museen. Sie hatten monatelang einen Kurator aus Samoa zu Gast, weitere Wissenschaftler aus dem Land sind gerade abgereist. Wie gestaltet sich die Kommunikation?
Tatsächlich ist unser Ansatz inzwischen sehr State of the Art. Was bei uns anders ist als in anderen Häusern: Wir haben mit einem groben Konzept begonnen, das auf ein Din-A4-Blatt passte. Darüber habe ich mit der damaligen Direktorin des Centers for Samoan Studies an der dortigen Universität diskutiert, und sie war gleich sehr angetan. Das ist jetzt fünf Jahre her. Wir haben die neue Ozeanien-Ausstellung von Tag eins an mit den Samoanern entwickelt, das Land steht im Mittelpunkt; bei der alten Ausstellung war das Neu-Guinea. In anderen Museen ist es derzeit eher so, dass den Vertretern und Vertreterinnen von Herkunftsgesellschaften als Gastkuratoren ein Ort, die Sammlung und Geld zur Verfügung gestellt werden. Und dann heißt es: Macht mal! Wir wollten das immer gemeinsam diskutieren und entwickeln. Das ist aber nicht immer der einfachste Weg.
Warum nicht?
Weil man die Welt mit unterschiedlichen Augen anschaut. Die pazifische Perspektive auf die Welt ist eine andere als unsere.
Inwiefern?
Sie beinhaltet das ganzheitliche Weltbild, das Land und Meer nicht voneinander trennt. Land und Meer werden als Einheit gedacht und bedingen einander. Das klingt jetzt einfach, aber es hat Zeit gebraucht, ehe wir uns reindenken konnten. Weil wir in Europa zu der Ansicht neigen, durch das Meer getrennt zu sein. Im Pazifik sagt man, man ist durch das Meer verbunden, und dass wir Menschen an Land nicht funktionieren können, wenn das Meer nicht funktioniert. In der Klimaforschung hat sich diese Position schon lange durchgesetzt. Und wenn man sich damit befasst, kann man das nur für selbstverständlich halten.
Wie werden Sie das in der Ausstellung umsetzen?
Wir werden das erläutern, aber auf keinen Fall mit dem Holzhammer kommen. Wir spielen damit. Bei uns fliegen Fische durch die Luft, und Masken stehen im Wasser. Daran kann man sich erfreuen, und man kann sich wundern und kommt so vielleicht ins Nachdenken. Wir möchten die Distanz aufheben, die es zwischen diesen beiden Denkweisen gibt.
Der Südpazifik ist eine Weltgegend, von der die meisten Menschen eher wenig wissen. Das macht es nicht leichter, oder?
Er ist auf der anderen Seite der Erde. Der Südpazifik spielt in der Schule ja auch beispielsweise keine Rolle. Die Aufarbeitung der deutschen Kolonialzeit kommt langsam in Gang, aber dann geht es meistens um Afrika. Aber warum wollten die Deutschen auch im Südpazifik Kolonien haben? Weiter weg ging es ja gar nicht. Damit befassen wir uns. Und weil man nichts voraussetzen kann, haben wir die Themen daraufhin abgeklopft und vertieft, um für alle Altersgruppen etwas anbieten zu können. Es gibt beispielsweise einen großen Globus, durch den man hindurchschauen kann. Wenn ich mich von den Chatham Islands durchbuddeln würde, würde ich in Bremen landen, natürlich direkt im Übersee-Museum! Wir lassen aber auch einiges weg. Australien kommt beispielsweise nur an zwei Stellen vor.
Wäre Australien nicht ein guter Anknüpfungspunkt gewesen, weil sich die Besucher darunter einiges vorstellen können?
Das stimmt. Wir werden Australien im ersten Stock intensiv behandeln, das ist in den nächsten Jahren als Teil einer Ausstellung mit dem Arbeitstitel "Fire and Ice" (Feuer und Eis, Anm. d. Red.) geplant, die sich den Extremen widmet. Sie soll als Bindeglied fungieren zwischen dem Pazifik im Erdgeschoss und der Amerika-Ausstellung im zweiten Stockwerk.
Die Ozeanien-Ausstellung wird mit der Neu-Eröffnung einen anderen Namen erhalten. Warum?
Ozeanien ist als Begriff zu unbekannt und als Kontinent auch. Australien galt lange als der fünfte Kontinent, was zu kurz gegriffen war. Deswegen haben wir uns für "Der blaue Kontinent – Inseln im Pazifik" entschieden. Einige von denen wie Papua-Neuguinea sind übrigens größer als Deutschland. Es ist ein großer blauer Kontinent, der sehr schön ist, und das soll sich durch die Ausstellung transportieren. Man soll richtig eintauchen können.
Sie möchten das Übersee-Museum außerdem zu einem "Dritten Raum" machen, in dem sich Menschen gerne aufhalten. Wie weit sind Sie damit?
Wie gehen einen Veränderungsweg mit vielen kleinen Schritten. Eine Stärke des Übersee-Museums ist diese wahnsinnig schöne Atmosphäre mit der hohen Aufenthaltsqualität. Da wollten wir draufsatteln, und einiges ist schon passiert: Wir haben im gesamten Museum Wlan, man kann in bestimmten Zonen picknicken. Das wird gut angenommen. Der nächste Schritt ist unsere neue Jahreskarte. Sie kostet 52 Euro, und ich kann sogar noch jemanden mitbringen. Das ist eine Geste an die Bremerinnen und Bremer, die es ermöglichen soll, das Museum als Ort noch anders wahrzunehmen.
Wie anders?
Man kann beispielsweise seine Mittagspause im Museum verbringen, etwas lesen, ein Sandwich essen oder sich mit einer Freundin treffen. Oder ich schaue mir die Ausstellung an. Vielleicht auch nur einen Teil davon.
52 Euro, um das ganze Jahr ins Museum gehen zu können – wie finanzieren Sie das gegen?
Wir bauen darauf, dass wir das durch mehr Besucherinnen und Besucher ausgleichen. Ich bin optimistisch, dass das klappt.