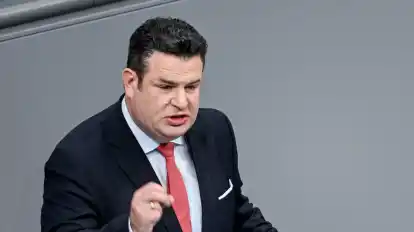In den Bremer Sozialberatungsstellen bitten immer mehr Menschen um Hilfe, weil sie die digitale Kommunikation mit dem Jobcenter überfordert. Auch die soziale Zusammensetzung der Hilfesuchenden hat sich im Zuge von Inflation und Energiepreiskrise verändert. Das berichten Mitarbeiter verschiedener Träger, die das alltägliche Beratungsgeschäft in den Stadtteilen leisten.
Zu diesen Einrichtungen zählt die Aktionsgemeinschaft arbeitsloser Bürgerinnen und Bürger, kurz Agab, die in Walle, Huchting und Tenever mit Büros präsent ist und aus Mitteln des Landes und des Europäischen Sozialfonds gefördert wird. Zwischen 4000 und 5000 Gespräche führen die Mitarbeiter übers Jahr. Daraus ergibt sich ein Bild über die Lebensumstände und Probleme der Menschen, die mit ihrem Geld gerade noch oder eben nicht mehr klarkommen – Erwerbslose, Geringverdiener, prekär Beschäftigte.
Gitta Barufke und Tjark Osterloh gehören zum Team der Agab, die an der Grenzstraße in Walle ihren Hauptsitz hat. Wer dort einen Termin vereinbart, hat meist Fragen rund um die diversen Sozialleistungen wie Bürgergeld (früher Arbeitslosengeld II), Wohngeld oder Elterngeld. Seit die Lebenshaltungskosten im vergangenen Jahr deutlich angestiegen sind, seien es nicht mehr fast ausschließlich Transferleistungsempfänger, die Beratung nachfragten. "Es suchen uns jetzt mehr Leute auf, die vorher knapp über die Runden kamen", sagt Barufke. Dazu zählten Mindestlohnempfänger und schlecht Ausgebildete, die vielleicht 1500 Euro im Monat verdienen. "Die hatten eigentlich keine Lust auf das Jobcenter und den ganzen Antragskram, der damit verbunden ist, sehen aber jetzt keine andere Möglichkeit mehr, weil sie finanziell an ihre Grenzen stoßen", sagt Barufke. "Rund ein Drittel unserer Ratsuchenden sind inzwischen Leute, die eine Vollzeitstelle haben oder Mini-Jobs, die nicht ausreichen", ergänzt Osterloh.
Die Agab-Mitarbeiter kommen häufig ins Spiel, wenn die Hilfesuchenden mit der Antragstellung beim Jobcenter überfordert sind oder Bescheide dieser Behörde nicht verstehen. Das betrifft oft Menschen mit geringen Deutschkenntnissen, aber nicht ausschließlich. "Kürzlich hatte ich hier jemanden sitzen, dessen Arbeitsstunden durch den Arbeitgeber reduziert worden waren. Nun wollte er ergänzende Leistungen beim Jobcenter beantragen und sollte dafür rund 30 Seiten Antragsformulare ausfüllen", sagt Barufke. "Da stoßen Leute einfach an ihre Grenzen."
Zugleich setze das Jobcenter immer mehr auf digitale Kommunikation mit den Leistungsbeziehern und fahre die klassische Betreuung durch Gesprächstermine mit Sachbearbeitern zurück. "Einen digitalen Leistungsantrag auszufüllen ist aber oft nicht einfach", sagt Osterloh. "Wenn man bestimmte Angaben nicht machen kann, weil einem die Daten fehlen oder Verständnisfragen auftauchen, kommt man da nicht weiter."
Dass das Jobcenter bestrebt ist, seine Kundschaft zu mehr digitaler Kommunikation zu erziehen, ist ein Eindruck, der bei der Solidarischen Hilfe in Vegesack geteilt wird. Rechtsanwalt Fabian Rust hat dort viele Gespräche mit Hilfesuchenden, die an den Online-Services der Behörde scheitern. Sein Eindruck: "Das Jobcenter will nur noch möglichst wenig direkte Kundenkontakte." Das sei auch ein Erbe der Pandemiezeit, als die Kommunikation zwischen Leistungserbringer und -beziehern fast ausschließlich schriftlich ablief. Nun sei es jedoch an der Zeit, "die Beratung wieder niedrigschwelliger zu erbringen", sagt Rust. "Online ist okay, aber es muss auch offene Anlaufstellen geben."
Beim Jobcenter tritt man dem Eindruck entgegen, es ziehe sich aus dem unmittelbaren Bürgerkontakt zurück. "Mit dem Ende des letzten Lockdowns halten wir die gleichen Öffnungszeiten vor wie vor der Pandemie. Jede Bremerin und jeder Bremer kann auch ohne Termin zu uns kommen", sagt Sprecherin Kersten Artus. Viele Dienstleistungen der Behörde gebe es inzwischen auch digital. "Wir raten, diese alternativen Angebote, die wir in den letzten drei Jahren deutlich ausgeweitet haben, zu nutzen", so Artus, sie seien aber "selbstverständlich freiwillig".
Die zunehmende Inanspruchnahme der Sozialberatungsstellen nicht nur durch Sozialleistungsbezieher, sondern auch durch Erwerbstätige wundert Sofia Leonidakis nicht. Seit mehr als einem Jahr gleiche die Lohnentwicklung die Inflation nicht mehr annähernd aus, sagt die Vorsitzende der Linksfraktion in der Bürgerschaft. "Gerade Beschäftigte mit niedrigen Einkommen sind dadurch in Bedrängnis geraten." In Bremen sei politisch bereits einiges für die Entlastung dieser Gruppe getan worden, doch es müsse mehr geschehen, zum Beispiel der Einstieg in den ticketlosen öffentlichen Nahverkehr.