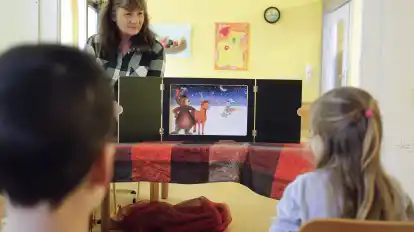In benachteiligten Stadtgebieten bringen die meisten Bremer Grundschüler eklatante Lücken mit, wenn sie an eine weiterführende Schule wechseln. Das zeigt einmal mehr der Vergleichstest Lale. Lale steht kurz für Lernausgangslagen-Erhebung. An den aktuellen Tests in Deutsch und Mathematik nahmen im Herbst fast 3500 Schülerinnen und Schüler der 5. und 7. Klassen teil.
Ein zentrales Ergebnis: Drei Viertel der Bremer Fünftklässler in belasteten Stadtgebieten erreichten beim Leseverstehen deutscher Texte nicht die Regelstandards. Sie haben deutliche Schwierigkeiten beim Lesen und können einen Text noch nicht als Ganzes erfassen. In Mathematik sind die Lücken noch größer: Hier erreichten 81 Prozent nicht den Regelstandard, 59 Prozent blieben sogar unter dem Mindeststandard. In besser situierten Gebieten erzielte die Mehrheit der Kinder deutlich bessere Leistungen. Zu erkennen sei "ein deutlicher Zusammenhang mit der sozialen Herkunft", heißt es in einem Bericht der Bildungsbehörde. Als belastet gelten Gebiete, in denen viele Eltern arbeitslos oder Geringverdiener sind, viele niedrige Bildungsabschlüsse haben, und die Sprachförderquote hoch ist.
Mit Blick auf Vergleichstests wie Lale gebe es Ängste auf allen Seiten, sagt Stephan Wegner, Leiter der Oberschule in den Sandwehen in Blumenthal, die seit drei Jahren an Lale teilnimmt. "Die Schüler haben Angst, dass sie schlecht abschneiden, die Lehrer haben Angst, dass sie etwas falsch gemacht haben." Aber wenn man dieses Analysewerkzeug richtig nutze, könne man Unterricht effektiver gestalten: "Man kann frühzeitig erkennen, wo man gegensteuern kann."
Probleme beim Einmaleins
Die Gründe, weshalb Kinder Hilfe brauchen, würden immer unterschiedlicher, sagt Wegner. „Auch Fünftklässler haben zum Teil noch Schwierigkeiten, den Stift zu halten. Früher haben das Elternhäuser übernommen, heute eben nicht mehr.“ Viele Fünftklässler hätten Probleme bei Einmaleins und Kopfrechnen, bei Addition und Subtraktion, so Wegner. Er stellt dabei klar: "Die Grundschulen machen eine super Arbeit, sie müssen aber Aufgaben der Kindergärten übernehmen. Und wir müssen Aufgaben der Grundschulen übernehmen – vieles verschiebt sich nach hinten."

Wenn die Tests in einer Klasse besonders große Lücken zeigen, könne die Schule konkret reagieren. Zum Beispiel schicke man zusätzliche Sprachförderkräfte stundenweise in diese Klasse, so Wegner. Zudem gebe es ab Herbst ein spezielles Modul mit drei bis vier Wochenstunden Förderung in den Kernfächern Deutsch, Mathe und Englisch.
Ähnlich wie Wegner äußert sich Carl Böhm, stellvertretender Schulleiter der Wilhelm-Olbers-Oberschule in Hemelingen: "Wenn die Kinder aus den Kitas und Grundschulen kommen, haben viele große Defizite", sagt Böhm. "Wir nehmen wahnsinnig viele Kinder auf, die sprachlich eher auf dem Niveau von Erst- oder Zweitklässlern sind." Bereits in Klasse 5 müsse die Oberschule viel aufholen. Dafür setze seine Schule unter anderem auf sieben Stunden pro Woche für sogenanntes "Individuelles Lernen". Gerade in dieser Zeit gehe es darum, Defizite aufzufangen, so Böhm. Es werde dann kein neuer Stoff vermittelt, sondern schwächere Schüler gefördert und stärkere Schüler mit schwierigeren Aufgaben gefordert.
Förderprogramme an Oberschulen
Oberschulen versuchen also, die Lücken durch besondere Förderung auszugleichen. Und an den Lale-Tests lässt sich ablesen, dass dies auch Wirkung zeigt. Mehr als 1300 Kinder nahmen erst als Fünftklässler und nun erneut als Siebtklässler an den Tests teil. An allen Schulen seien "deutliche Lernzuwächse" zu beobachten, so die Behörde. Beim Leseverstehen konnten Schulen in schwieriger Lage innerhalb von zwei Jahren besonders deutlich aufholen. "Obwohl bei uns viele Schüler mit viel Hilfebedarf ankommen, verlassen 40 Prozent unsere Schule mit einem mittleren Schulabschluss (MSA) mit Berechtigung für die gymnasiale Oberstufe", so Wegner.
Bildungssenatorin Sascha Aulepp (SPD) betonte, sie freue sich, wie viele Schulen freiwillig an dem Test teilgenommen hätten. So könnten Schulen herausfinden, wo sie stehen und was sie voneinander lernen könnten. Klar sei angesichts der Lale-Ergebnisse: "Da gibt es nichts zu beschönigen: Die Ergebnisse zeigen anhaltenden Handlungsbedarf." Die Ergebnisse seien Ausdruck einer tiefen sozialen Spaltung der Gesellschaft. "Die wird nicht allein mit Bildungspolitik überwunden", betonte Aulepp.
Opposition übt scharfe Kritik
Die Lale-Ergebnisse führten "erneut schmerzlich vor Augen", wie verfestigt und ausgeprägt sich soziale Herkunft auf den Schulerfolg auswirke, sagt Bildungspolitikerin Yvonne Averwerser (CDU). Man müsse bei Kindern in benachteiligten Quartieren mitunter von Lernrückständen von mehreren Jahren im Vergleich zu Schülerinnen und Schülern an Gymnasien und in sozial bessergestellten Quartieren ausgehen. Die angestrebte Entkopplung von sozialer Herkunft und Bildung rücke in Bremen in "utopisch weite Ferne". Konkrete Vorschläge der CDU für ein vorschulisches Angebot speziell für Sprachförderkinder seien abgeschmettert worden.
"Wenn Siebtklässler wie Grundschüler rechnen und Texte nicht sicher verstehen können, dann ist das ein Skandal, an den wir uns nicht gewöhnen können", sagt Birgit Bergmann (FDP) und spricht von "chronifiziertem Versagen". Die FDP traue dem Bremer Senat nicht mehr zu, die Bildungslandschaft sinnvoll zu reformieren.
Keine Pandemie-Folgen ablesbar
Verwundert zeigen sich Behördenvertreter und Schulleitungen davon, dass an den Lale-Ergebnissen keine Pandemie-Folgen abzulesen sind: Die Punktzahlen von Fünftklässlern unterschieden sich 2021 nicht statistisch relevant von 2019. "Wir sind überrascht, wir sehen im Prinzip keine Auswirkungen der Corona-Einschränkungen auf die Leistungen", sagt Carolin Richtering, bei der Bildungsbehörde zuständig für Lale ist. Diese Beobachtung hat auch Wegner gemacht. Seine Schüler hätten sich in den Tests von 2019 zu 2021 sogar verbessert, sagt er: "Leistungseinschränkungen sind de facto nicht vorhanden." Unübersehbar seien aber die sozialen Folgen, so Wegner: „Die Schüler sind natürlich viel stiller geworden, das Schulleben war vorher viel bunter.“ Zudem falle ein "unendlicher Bewegungsdrang" in den Pausen auf: "Die Kinder freuen sich richtig, sich den Berg runterkugeln zu lassen.“