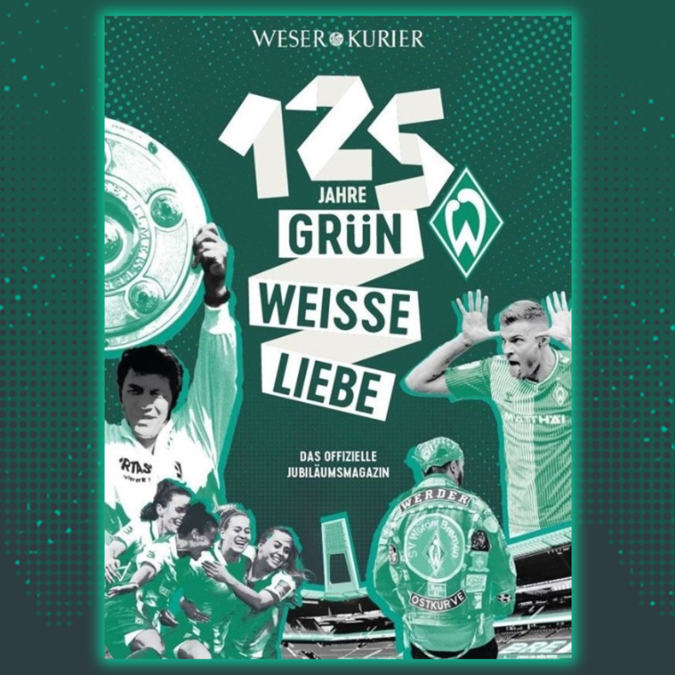Einst war sie eine der größten Werften Europas und einer der größten Arbeitgeber in Bremen: Für die Hansestadt war die AG Weser über viele Jahrzehnte ein Aushängeschild, für Tausende Menschen ein Teil ihrer Identität. Umso größer war der Schock, als 1983 das Aus der Großwerft feststand. In dieser Fotostrecke blicken wir mit historischen Aufnahmen auf die Werft und ihre Werke, wie sie sich über Jahrzehnte entwickelt haben.
Bremer Wirtschaftsgeschichte Die Werft und ihre Werke: Die Geschichte der AG Weser in Bildern
Vor 40 Jahren wurde das Ende der Großwerft AG Weser besiegelt. Ein kollektives Trauma, das Bremen bis heute verarbeitet. In dieser Bilderstrecke erzählen wir die 140-jährige Geschichte der Traditionswerft.
1846: Flussdampfer "Roland"
Unten rechts auf dem Gemälde von Carl Justus Harmen Fedeler (1846) ist der Flussdampfer "Roland I" vor Bremerhaven zu sehen. Der Seitenraddampfer beförderte Passagiere zwischen Bremen und Bremerhaven. Da die Roland (I) 1847 außer Betrieb gesetzt wurde, beuaftragten die Besitzer die Bremer Werft C. Waltjen & Co., die später zur AG Weser wurde, einen nunmehr eisernen Dampfer mit geringerem Tiefgang zu bauen. Der neue „Roland“ (II) genannte Raddampfer erhielt die Maschine und die Räder seines hölzernen Vorgängers.

1909: Erste Klasse im Schnelldampfer "Berlin"
Der Schnelldampfer "Berlin" wurde auf der AG Weser für den Mittelmeer-New-York-Dienst hergestellt. Räumlichkeiten der waren Klasse sind mit schweren Stoffen, wuchtigem Mobiliar und festlichen Kronleuchtern ausgestattet – der Prunk des deutschen Kaiserreiches.

1914: Schnelldampfer "William O'swald"
Zwischen Arbeiterstreiks und Aufrüstung entsteht der Schnelldampfer "William O'swald", benannt nach einem Hamburger Kaufmann und Bürgermeister. Das Schiff wurde für die Hamburger Reederei Hapag angefertigt. Zum Stapellauf kamen zahlreiche Besucher.

1920: Stapellauf und AG-Weser-Arbeiter
Beeindruckende Dimensionen: Ein Arbeiter der AG Weser kurz vor dem Stapellauf eines großen Schiffs.

16. August 1928: Luxusdampfer "Bremen"
Reichspräsident Paul von Hindenburg taufte die "Bremen", am selben Tag lief der Schnelldampfer vom Stapel. Nach einigen Probefahrten startete sie am 16. Juli 1929 ihre Jungfernfahrt von Bremerhaven nach New York. Sie gewann 1929 das Blaue Band als schnellstes Schiff auf der Transatlantik-Route. Am 16. März 1941 brach an Bord der "Bremen" ein Feuer aus, das trotz aller Bemühungen der Bremerhavener Feuerwehr nicht gelöscht werden konnte. Das Schiff brannte fast völlig aus und wurde daraufhin verschrottet.

Sie wollen mehr Geschichten und Fotos zur maritimen Geschichte Bremens sehen? Im Magazin "Erst der Hafen, dann die Stadt" blickt der WESER-KURIER auf die bremischen Häfen und ihre Geschichte. Wie entwickelten sich die Häfen in Bremen vom Mittelalter bis heute? Wie sah die Arbeit zwischen Ladeluke, Kaje und Schuppen aus? Was hatte es mit den Anbiethallen auf sich? Und wie veränderte die Containerschifffahrt die stadtbremischen Häfen? Das Magazin ist erhältlich in unseren Kundenzentren, im Buch- und Zeitschriftenhandel, telefonisch unter 04 21 / 36 71 66 16, im Internet unter shop.weser-kurier.de sowie als In-App-Kauf in der E-Paper-App.

1938: U-Boot-Flottile "Lohs" im Freihafen II
Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg wird die AG Weser ganz auf Kriegsschiffbau umgestellt. Bis 1945 produzierte die Werft 150 U-Boote. Um die Jahrhundertwende wurde in der heutigen Überseestadt ein zweiter Freihafen gebaut. Dort wurde die Unterseebootflottille "Lohs" gesichtet, die im Oktober 1937 in Kiel aufgestellt und stationiert wurde.

7. April 1951: Mitarbeiterversammlung der AG Weser
Bürgermeister Wilhelm Kaisen spricht vor Werftarbeitern. Er hatte bei den Alliierten die Aufhebung des Schiffbauverbots erwirkt. Werftdirektor Peter Burkhardt wies als großen Erfolg der AG Weser aus, sich trotz der harten Zeit der Nachkriegsjahre und der Zerstörung der Werft immerhin einen kleinen Stamm von Facharbeitern erhalten zu haben.

16. Juli 1953: Helling und Montagehalle
Zwei Jahre nachdem die Schiffbaubeschränkung durch die Alliierten wieder aufgehoben wurde, begann der Wiederaufbau der demontierten und zerstörten Werft begonnen. Mit dem neu aufgebauten Helgen 5 war die Montagehalle verbunden. Hier wurden bis zu 30 Tonnen schwere Schiffsteile geschweißt. Die Schweißhalle war das Kennzeichen des damaligen Schiffbaus: Sie ermöglichte eine schnellere Fertigstellung der Schiffe und damit eine kürzere Belegung der Helgen.

April 1953: Landesweite Arbeitskämpfe
17.000 Beschäftigte aller Werften legten landesweit die Arbeit nieder. Die Arbeiter wollten mehr Rechte und von der anziehenden Konjunktur profitieren. Die Forderungen: Lohnerhöhung um acht Pfennige, bessere Bedingungen beim Akkordlohn und mehr Rechte für Lehrlinge. Die Arbeitgeber fürchteten die Konkurrenz ausländischer Werften und kündigten einen Lohnstopp an. Die IG Metall wollte einlenken, doch die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) war dagegen und gründete eine zweite Streikleitung. Nach sechs Wochen wurde der Streik beigelegt, es kam zu einer Lohnerhöhung von fünf Pfennigen pro Stunde.

11. August 1954: Schweißer bei der Arbeit
Ein Arbeiter schweißt Schiffsteile für den Tanker "Esso Düsseldorf". Ohne Mundschutz und ohne Helm. Arbeitsschutz spielte damals kaum eine Rolle. Erst Ende der 60er-Jahre wurden Schutzmaterialien umsonst herausgegeben. Dazu gehörten Schutzanzüge, Schuhe, Handschuhe und Helme.

5. März 1955: Stapellauf der "Esso Frankfurt"
Schwung in der Schiffbaubranche: Die Esso AG wollte den westdeutschen Mineralölimport sicherstellen und stieg mit einer Reederei in den Tankerbau auf der AG Weser ein. Der Tanker "Esso Frankfurt" hatte eine Tragfähigkeit von 26.650 Tonnen. Werftarbeiter schmückten das Schiff für den Stapellauf.

2. Juni 1961: Letzte Arbeit vor dem Stapellauf
Dieser hoch aufragende Schiffskörper wird zur Zeit der Aufnahme nur noch wenige Wochen auf dem Helgen der AG Weser liegen. Es war zu dieser Zeit der größte bisher an der Weser gebaute Tanker. Er entstand im Auftrag der Esso Petroleum Co. in London und hatte bei Fertigstellung eine Tragfähigkeit von 78.000 Tonnen, war 260 Meter lang und 34 Meter breit.

Oktober 1968: Zwei Bockkräne – ein Wahrzeichen
Nachdem die alte Gerüsthelling der Bremer Großwerft demontiert worden war, beherrschten die beiden gewaltigen Bockkräne die Szenerie. Mit ihren Hebekräften von 780 und 500 Tonnen machten sie den Bau von riesigen Schiffen in Groß-Sektionen möglich. Bei der Kiellegung des ersten 255.000-Tonnen-Tankers für die Esso arbeiteten die beiden Krangiganten erstmals "Hand in Hand" zusammen.

16. Juni 1969: „Esso Scotia" liegt quer im Fahrwasser
Schaulustige blicken vom Lankenauer Höft auf die „Esso Scotia". Der Turbinentanker mit 253.000 Tonnen Tragfähigkeit lag quer im Fahrwasser – am Bug und am Heck fest. Das bis dahin größte in Europa gebaute Schiff blockierte die Weser und drohte die stadtbremischen Häfen vorübergehend vom internationalen Seeschiffsverkehr abzuschneiden. Durch einen Sturm rissen zwei Seile, das Schiff war samt Montagetrupp ins Wasser getrieben. 18 Schlepper zogen den Koloss Stück für Stück an den Ausrüstungskai zurück.

27. August 1973: "Tag der offenen Tür" bei der AG Weser
Besucherinnen und Besucher stehen Schlange vor der Kantine II. Sie konnten sich für eine Mark pro Teller eine Portion Erbsensuppe abholen. Wie der WESER-KURIER berichtete, waren die 6000 Portionen jedoch schneller vergriffen als gedacht. Rund 50.000 Menschen besuchten an diesem Tag das Werftgelände. Sieben Informationsstände lieferten Broschüren und Lagepläne für die Fußgänger. Drei Busse transportierten die Besucher über das weitläufige Gelände. Veranstaltungen wie diese sollten einen Ausgleich bieten für die Stapelläufe, bei denen Bürgerinnen und Bürger seit einiger Zeit nicht mehr teilnehmen durften. Der Grund: Bei einer voll arbeitenden Werft gab es zu viele Gefahrenquellen.

1975: Die AG Weser von oben
Das frühere Betriebsgelände als Luftbild. Etwas versetzt sind gut deutlich die blauen Bockkräne zu sehen. Erkennbar sind auch die Helgen, auf denen die Schiffe gebaut wurden. Die Werftinsel und die Landzunge zum Lankenauer Höft sind begrünt.

17. September 1980: Proteste auf dem Marktplatz
Hans Koschnick (SPD) unterbricht eine Landtagssitzung, um am Megafon zu den demonstrierenden AG-Weser-Beschäftigten auf dem Marktplatz zu sprechen. Der Bremer Bürgermeister sagte zu, dass er sich für den Erhalt des Neubaubereiches der Werft einsetzen werde. Durch die geplante Neuorganisation der Eigner waren bis zu 400 Arbeitsplätze in Gefahr.

15. September 1983: Wiederkehrende Proteste
"Wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt" stand auf einem Spruchband, dass über der Straße am Haupttor der AG Weser gespannt ist. Die Lage ist angespannt. Viele Beschäftigte hegen noch Hoffnung auf ein Überleben der AG Weser. Kurz darauf kommt es zu einer Besetzung nach dem Vorbild der HDW in Hamburg.

20. September 1983: Frauen der Schiffbauer schließen sich Protest an
Nach der Besetzung der AG Weser zogen auch die Frauen der Schiffbauer mit Transparenten durch die Straßen Gröpelingens, um die Bevölkerung zu informieren. Bereits am frühen Morgen versammelten sich Ehefrauen mit einem Spruchband und roten Nelken vor dem Werkstor.

23. September 1983: Hans Koschnick auf der Belegschaftsversammlung
Auf der letzten Betriebsratssitzung der AG Weser muss Bürgermeister Hans Koschnick der Belegschaft der AG Weser mitteilen, dass die Werft schließen wird. Der Betriebsratsvorsitzende Hans Ziegenfuß gab am Ende der dreistündigen Versammlung unter dröhnendem Applaus Koschnick sein SPD-Parteibuch zurück.

14. Dezember 1983: Symbolreicher Abschied
Ehemalige AG-Weser-Arbeiter lassen nach einem symbolischen Trauerzug mit schwarzen Zylindern und Fahnen einen selbst gezimmerten Sarg ins Wasser. "Use Akschen" für immer vorbei. Zahlreiche Pressevertreter waren erschienen. Anschließend tauften die Arbeiter ihr letztes Schiff, die "Ubena".

1984: Straßenname aus Protest geändert
Kurz nach der Werftschließung benannte der Senat die Straße entlang des heutigen Einkaufszentrum Waterfront nach dem ehemaligen Generaldirektor der AG Weser, Franz Stapelfeld. 1984 montierten Gröpelinger Bürger ein neues Schild. Es trug nun den Schriftzug „Use Akschen". Die eigentliche Benennung war den Gröpelingern zuwider, weil Stapelfeld nicht nur AG-Weser-Vorsitzender war, sondern auch NSDAP-Mitglied und Wehrwirtschaftsführer in der NS-Zeit.

15. April 1987: Arbeiterverein "Use Akschen" zieht um
"Use Akschen" ist umgezogen. Der Vorstand des Vereins der ehemaligen AG-Weser-Beschäftigten präsentierte den Mitgliedern und der Öffentlichkeit die neuen Räumlichkeiten am Schiffbauerweg. Im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme bauten 20 Arbeitskräfte in sechs Monaten das 250 Quadratmeter große ehemalige Bürohaus 2 der AG Weser aus.

2003-2004: Space Park Bremen
Es sollte eines der größten Projekte werden, das Bremen je umgesetzt hat, und es sollte den gebeutelten Stadtteil Gröpelingen wieder aufwerten: der Space Park Bremen. Er ging aber als einer der größten wirtschaftlichen Flops in die Bremer Geschichte ein. Die Betreiber wollten bei den Besuchern Illusionen wecken und sie für die Raumfahrt begeistern. Doch in den rund sieben Monaten nach seiner Öffnung kamen lediglich 350.000 Besucher in den damals deutschlandweit einmaligen überdachten Freizeitpark, kalkuliert worden war mit etwas weniger als der doppelten Anzahl.

2008 bis heute: Einkaufszentrum Waterfont
Das Einkaufszentrum Waterfront wurde am 12. September 2008 eröffnet. Neben Einkaufsmöglichkeiten gibt es dort auch ein Kino und zahlreiche Cafés und Restaurants. Dort, wo früher die Schiffe vom Stapel gelaufen sind auf der großen Treppe hinter dem Gebäude, betreibt das Metropol Theater seit 2021 in den Sommermonaten die Seebühne.