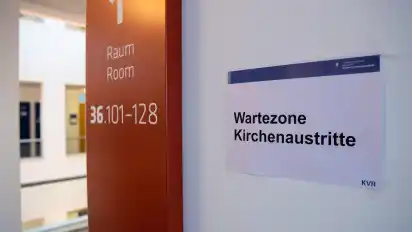Christof Haverkamp ist nicht sonderlich schockiert. "Wir sind ja schon seit den Tagen der Reformation in Bremen eine Minderheit", sagt der Sprecher des katholischen Gemeindeverbandes in Bremen. Gerade einmal knapp 65.000 Bremerinnen und Bremer bekennen sich derzeit noch zur römisch-katholischen Kirche, rund 9,5 Prozent der Einwohner. Auch seine protestantische Kollegin Sabine Hatscher, Sprecherin der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK), sieht keinen Grund zur Unruhe. "Die Bedeutung des Glaubens und des Christentums macht sich nicht allein an unseren Mitgliederzahlen fest", kommentiert sie die Meldung, dass Ende 2021 erstmals weniger als die Hälfte der Einwohner Deutschlands einer der beiden großen Konfessionen angehören dürften.
Die von der humanistischen Giordano-Bruno-Stiftung finanzierte Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (Fowid) hatte diesen Befund im Vorgriff auf die im Sommer zu erwartenden offiziellen Zahlen hochgerechnet und veröffentlicht. Demnach gibt es noch 19,7 Millionen Protestanten und 21,8 Millionen Katholiken hierzulande. Im Vorjahr waren es noch jeweils rund eine halbe Million mehr Gläubige. "Es ist eine historische Zäsur, da es im Ganzen gesehen seit Jahrhunderten das erste Mal in Deutschland nicht mehr normal ist, Kirchenmitglied zu sein", wird der Berliner Sozialwissenschaftler Carsten Frerk von Fowid dazu bei Spiegel Online zitiert.
Mutmaßlich, weil Bremen diesen historischen Einschnitt schon länger hinter sich hat, geben sich die beiden Kirchensprecher entspannt. Zu den 9,5 Prozent Katholiken gesellt sich aktuell ein noch rund 26 Prozent umfassender protestantischer Bevölkerungsanteil. Damit bekennt sich derzeit insgesamt nur ein gutes Drittel der Landeskinder zu den beiden großen Konfessionen. Im Jahr 1995 galt das noch für deutlich über 50 Prozent, 1970 waren noch knapp 78 Prozent der Bremer Bevölkerung entweder protestantisch oder katholisch.
Haverkamp ist trotz dieser sinkenden Mitgliederzahlen davon überzeugt, dass christliche Werte und das christliche Menschenbild weiterhin von Bedeutung sind und unseren Alltag positiv beeinflussen. "Dinge wie Nächstenliebe oder Gerechtigkeit haben nach wie vor eine sehr hohe Akzeptanz. Sie sind in die Gesellschaft eingedrungen und leben heute in weltlicher Gestalt etwa als Solidarität oder Fairness fort", zitiert er einen Religionssoziologen und verweist sogar auf Max Weber, den Gründervater der modernen Soziologie. Der habe schon um 1900 formuliert, dass moderne Gesellschaften religiöse Motive aufgenommen und transformiert haben, sodass sie auch ohne religiöse Fundierung weiter bestehen. "Ich glaube, das äußert sich zum Beispiel in vielfältiger ehrenamtlicher Arbeit und derzeit auch in der großen Hilfsbereitschaft gegenüber den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine", sagt Haverkamp. Das könnten staatliche Behörden allein und ausschließlich professionell nicht in dieser Form organisieren.
BEK-Sprecherin Hatscher ist sich ebenfalls sicher, dass prinzipielle Hilfsbereitschaft und die Bereitschaft sich gesellschaftlich zu engagieren zentral mit dem Christentum und seinen Werten verbunden ist, aber heute unabhängig von der Kirchenzugehörigkeit der jeweils Handelnden existieren. "Amtlich registriert werden außerdem allein die Kirchensteuerzahler", sagt sie. Berücksichtige man die vielen Angehörigen von Freikirchen und orthodoxen Gemeinden, bildeten Christen nach wie vor die Mehrheit in Deutschland. "Außerdem ist es nicht so, dass wir Mitglieder vor allem durch bewussten Austritt verlieren." Der demographische Wandel setze der BEK mehr zu.
Neben den Kirchen hat auch die CDU das Christentum im Firmenschild. Gerade erst hat der Evangelische Arbeitskreis (EAK) der CDU Bremen seinen Landesvorsitzenden wiedergewählt: Claas Rohmeyer, zugleich Sprecher für Kirche und Religionsgemeinschaften der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Wegen der zurückgehenden Mitgliederzahlen der beiden großen Konfessionen sieht er keinen Grund, den Arbeitskreis auszulösen. „Es gibt ein christliches Menschenbild, in dem sich unsere Politik gründen muss, ganz unabhängig und losgelöst von der Kirchenzugehörigkeit", sagt er. Der EAK wirke in diesem Sinne vor allem in die Partei hinein. Der Kern dieses Menschenbildes sei die Überzeugung, den Menschen so zu nehmen, wie er eben ist: fehlbar und unvollkommen. "Daraus ergibt sich eine Politik, die versucht zu helfen, zu unterstützen, aber immer auch das eigene Bemühen des Einzelnen einfordert."