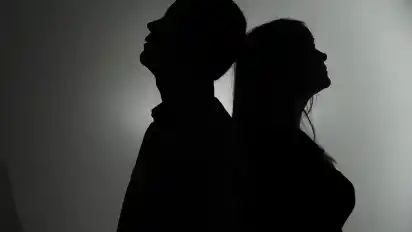Eigentlich könnte man sagen, dass es schon früher so war: Der CDU-wählende Vater stritt mit der Tochter, die sich für die Grünen begeisterte, die FDP-nahe Ehefrau mit ihrem Mann, der sich als traditioneller Sozialdemokrat sah. Die Linken machten sich über das Spießertum der Konservativen lustig, die sich mit dem Vorwurf revanchierten, dass die Sozen noch nie mit Geld umgehen konnten. Man debattierte, mitunter auch heftig, doch am Ende wusste jeder, dass auch der andere dasselbe Wertefundament teilt und man eine gemeinsame Basis hat. Eine gute Freundschaft hält das aus, enge Familienbande erst recht.
Doch es hat sich etwas verändert. Der Ton der Debatten ist deutlich rauer geworden, der Streit härter. Mit der Flüchtlingskrise 2015 taten sich bereits tiefe Gräben zwischen den politischen Lagern auf, und mit Corona hielt eine Unversöhnlichkeit Einzug, die vorher kaum denkbar war. Dann kam Russlands Krieg gegen die Ukraine, und auch hier prallen die Meinungen mit aller Wucht aufeinander. Von dieser Entwicklung bleiben selbst Familien und Freundschaften nicht verschont. Womit sich letzten Endes die Frage stellt, ob die Krisen unserer Zeit das Potenzial haben, sogar engste verwandtschaftliche Bande zu zerreißen.
Jeder Fünfte hat beim Thema Corona Freunde verloren
Ganz so weit ist es bei der 53-Jährigen noch nicht, die von ihren Erfahrungen berichtet, doch ist ihr Verhältnis zu ihrer älteren Schwester mittlerweile nachhaltig belastet. Bei dieser bemerkte sie mit Beginn der Pandemie ein generelles Misstrauen und eine Abneigung gegen „die Politik“. Diskussionen zu führen, wurde immer schwieriger: „Sie stellte alles infrage, musste immer dagegen sein“, sagt die Abteilungsleiterin bei einer Versicherung, die nicht noch Öl ins Feuer gießen und deshalb ihren Namen nicht in der Zeitung sehen möchte. Debatten wurden immer mit den gleichen Floskeln beendet: „Ich denke halt anders“ oder „Ich informiere mich breiter.“ Mit diesem „breiter“ meinte die Schwester die sozialen Medien, aus denen sie ihre Informationen bezog. „Wir haben uns richtig in die Haare gekriegt und konnten irgendwann nicht mehr über Corona sprechen“, sagt die 53-Jährige heute. Denn Argumenten gegenüber sei ihre Schwester nicht zugänglich gewesen. „Sie bügelte alles ab.“ Irgendwann kamen auch ominöse finstere Mächte ins Spiel, die die ganze Pandemie angeblich aus dem Hintergrund steuerten. Die klassische Verschwörungserzählung also.
Auseinandersetzungen wie diese können Familien in Not bringen und Freundschaften zerbrechen lassen. Einer Studie vom Sommer letzten Jahres zufolge hat jeder Fünfte (20 Prozent) wegen Meinungsverschiedenheiten beim Thema Corona Freunde verloren. Noch mehr Befragte, 27 Prozent, gaben an, dass Differenzen zum Ukraine-Krieg freundschaftliche Beziehungen belasten.
Selbst engste verwandtschaftliche Bindungen könnten durch solche Konflikte bedroht werden, sagt die Leiterin des Familiennetzes Bremen, Anja Lohse. Erst vor einiger Zeit habe sie einen Anruf von einer Frau bekommen, deren Familie wegen grundsätzlicher Meinungsverschiedenheiten beim Thema Impfen kurz vor dem Scheitern stand. Für Lohse ist klar: Die Kontrahenten müssen reden. „Die entscheidende Frage ist: Wie handelt man die Sachen aus?“
Verhärtete Fronten führen zu Funkstille
Nikolai Geils-Lindemann rät, dem Gegenüber interessiert zuzuhören, ohne gleich dagegenzuhalten. Andernfalls schaukele man sich gegenseitig hoch und gerate schnell in ein „Empörungskarussell“, was niemandem weiterhelfe, so der Familientherapeut von der Erziehungsberatungsstelle Bremen-Nord. Eine andere Möglichkeit wäre, das Thema zu wechseln. Sei das nicht mehr möglich, helfe manchmal nur noch Abgrenzung und die klare Ansage: Das wird mir jetzt gerade zu viel! Um keinen Bruch zu riskieren, müsse man „die innerliche Dämonisierung des anderen vermeiden“. Es sei einfach schade, wenn ein einzelnes kontroverses Thema all das Verbindende überlagere, das es mit dem anderen gebe.
Mitunter braucht es zur Konfliktentschärfung auch professionelle Unterstützung. Anja Lohse rät deshalb: „Wer das Gefühl hat, dass die Sache aus dem Ruder läuft, sollte sich nicht scheuen, eine der vielen Beratungsstellen zu kontaktieren und Hilfsangebote zu nutzen.“ Dazu muss es allerdings erst einmal ein Problembewusstsein und die Einsicht geben, dass die Dinge im Argen liegen und man daran etwas verändern möchte – eine ziemliche Hürde, die nicht jeder überspringt. Denn oft verhärten sich die Fronten so sehr, dass Funkstille einkehrt.
So war es auch bei einer 49-jährigen Bremerin, die wegen der Brisanz des Konflikts ebenfalls nicht namentlich zitiert werden möchte. Ursache des Zerwürfnisses mit ihrer Schwester und weiteren Verwandten war der Krieg in der Ukraine. Beide Frauen kamen als Russlanddeutsche mit ihrer Familie Anfang der 1990er-Jahre nach Deutschland. Während die 49-Jährige klar zur Ukraine hält, rechtfertigt ihre Schwester, die auch heute noch russisches Fernsehen schaut, Putins Vorgehen. Die Folge: Telefonate endeten im lautstarken Streit, schließlich ging man sich aus dem Weg. „Wenn es nicht meine Schwester wäre, hätte ich mit ihr gebrochen“, sagt die 49-Jährige. So aber hielt die Beziehung, indem man Gespräche über den Krieg tunlichst vermied.
„Das Unbeschwerte ist weg.“
Der russische Angriff auf die Ukraine hat tiefe Gräben hierzulande aufgerissen – doch wohl nirgendwo sind sie so tief wie in der russlanddeutschen Community. Während die einen sich mit ihrer neuen Heimat und der ihrer Vorfahren identifizieren, sind die anderen auch nach Jahrzehnten mental immer noch nicht richtig angekommen, schauen russisches Staatsfernsehen und glauben Putins Propaganda von den ukrainischen Nazihorden und dem kriegslüsternen Westen. Die 49-Jährige kann das nur schwer ertragen: „Meine Schwester weiß, wie wir in der Sowjetschule der Gehirnwäsche unterzogen wurden, wie der Antiamerikanismus und die Kriegslust uns im Schulunterricht anerzogen wurden und glaubt dennoch dem Ex-KGB-Offizier Putin und seinem Apparat.“ Selbst die Erinnerungen an die sowjetischen Verbrechen, die an den eigenen Großeltern verübt wurden – und die jetzt wieder in der Ukraine begangen werden –, seien verblasst.
Ob Ukraine-Krieg oder Corona: Die innerfamiliären Auseinandersetzungen hinterlassen mitunter Narben. Selbst wenn sich die Konflikte eindämmen lassen – so unbelastet wie vorher werden die Beziehungen oft nicht mehr. „Dass zwischen uns kein Blatt Papier passt, kann ich so heute nicht mehr sagen“, beschreibt die eingangs zitierte 53-Jährige ihr jetziges Verhältnis zur Schwester. „Das Unbeschwerte ist weg.“