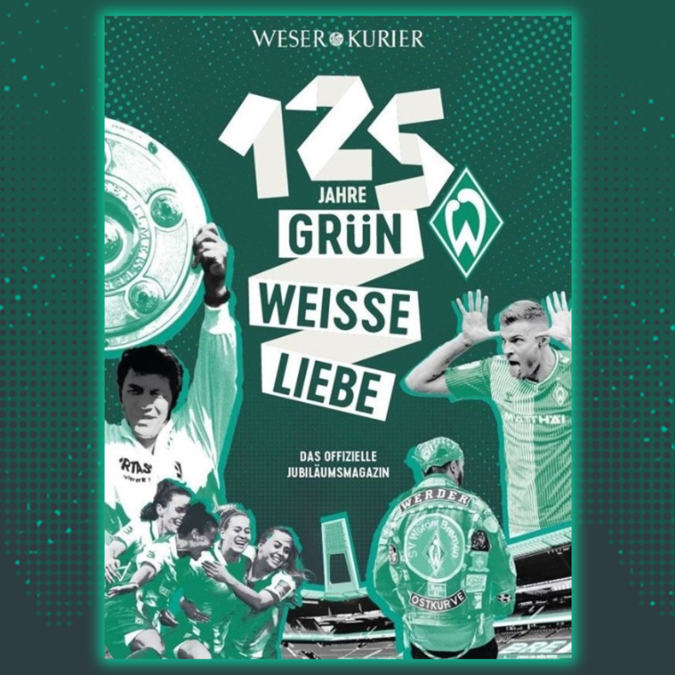Rassistisch sind nur die anderen? So ist es eben nicht. Auch die Wissenschaft sagt: Wir leben in einem rassistischen System. Genau das macht es so schwer selbst nicht rassistisch zu denken und teilweise auch zu handeln. Die gute Nachricht ist aber: Rassismus kann man verlernen. Das erfordert – neben dem Willen dazu – gezielte Weiterbildung. Wie gut, dass das Material dazu bereits existiert. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.
Fotostrecke Rassismus verstehen: Diese Bücher, Podcasts und Kanäle helfen dabei
Rassismus ist erlernt - und kann auch wieder verlernt werden. Wir geben Tipps für Antirassismus-Lektüre, Podcasts und andere Kanäle für die eigene Weiterbildung.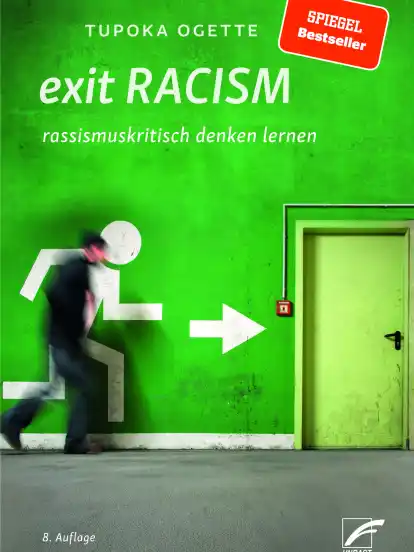
"Exit Racism" von Tupoka Ogette macht Rassismus in Deutschland zum Thema. Die Autorin ist hauptberuflich Antirassismus-Trainerin und -Beraterin, begleitet Unternehmen bei diesen Prozessen und gibt Workshops und Uni-Kurse. Ihr Buch behandelt nicht nur ihr eigenes Leben als Antirassismus-Trainerin und schwarze Frau in Deutschland, sondern setzt sich auch mit der Entstehung und Struktur von Rassismus auseinander und gibt ganz konkrete Tipps, wie sich Verhaltens- oder Denkmuster reflektieren lassen. Seit diesem Jahr ist die Hörbuch-Version von "Exit Racism" kostenfrei auf Spotify zugänglich.
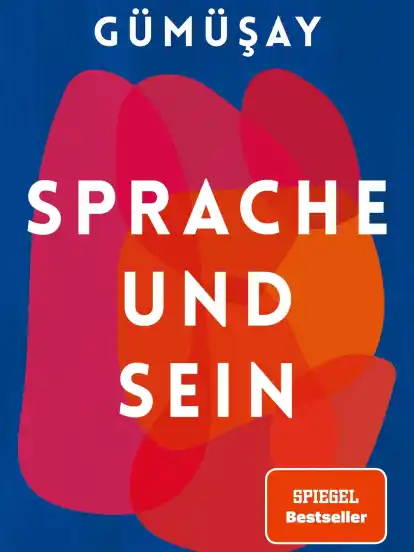
In "Sprache und Sein" erklärt Kübra Gümü?ay, wie Sprache das Denken beeinflusst. Darin geht es unter anderem auch um Stereotype, die einen ganzen Katalog von Vorurteilen beinhalten und in nur einem einzigen Wort ausgedrückt werden können. Das erklärte Ziel dieses Buchs: Eine Sprache etablieren, die Menschen als Individuen betrachtet und nicht in Kategorien steckt.
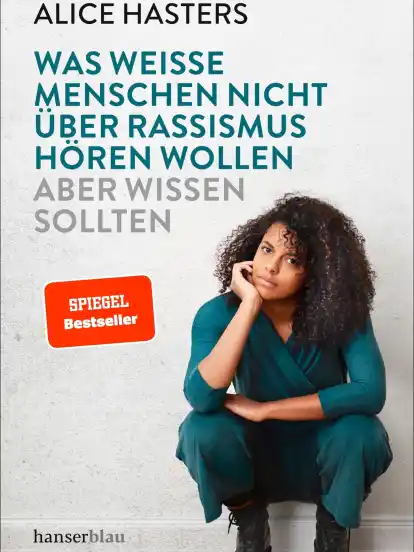
In "Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen" erfahren die Leser, welche Erfahrungen die Journalistin und Autorin des Buches, Alice Hasters, in ihrem Leben mit Rassismus machen musste. Hasters benutzt diese Erfahrungen, um weißen Menschen ganz konkrete Beispiele von Alltagsrassismus näherzubringen, die sie selbst vielleicht gar nicht als Rassismus erkannt hätten. „Darf ich mal deine Haare anfassen?“, „Kannst du Sonnenbrand bekommen?“, „Wo kommst du her?“ - Hasters erkennt an: Wer solche Fragen stellt, meint es meist nicht böse. Rassistisch ist es dennoch. Wieso, erklärt die Autorin in ihrem Buch. Auch "Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen..." ist seit Kurzem als Hörbuch-Version auf Spotify verfügbar.

Der Podcast "Rice and Shine" der Journalistinnen Minh Thu Tran und Vanessa Vu hat zum Ziel, vietnamesische Menschen in Deutschland sichtbar zu machen und thematisiert ihre Perspektiven, Wünsche und eigene Erfahrungen. Dazu haben die beiden Frauen auch regelmäßig Gäste in der Sendung. Der Podcast wurde 2019 für den Grimme Online Award nominiert.
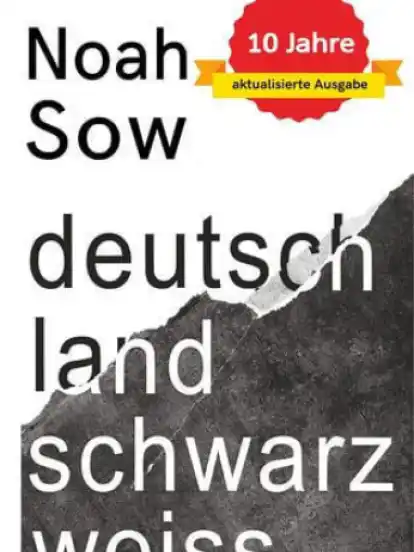
"Deutschland Schwarz Weiß: Der alltägliche Rassismus" von Noah Sow thematisiert humorvoll und direkt, wo uns in Deutschland alltäglich Rassismus begegnet und nennt dafür nicht nur Beispiele aus der Werbung, sondern auch aus der Kultur.

"Scene on Radio - Seeing White" ist ein Podcast des US-amerikanischen Journalisten John Biewen. In der 14-teiligen Staffel aus dem Jahr 2017 beschäftigt sich Biewen mit Rassismus aus der Perspektive eines weißen Mannes - seiner eigenen. Er reflektiert eigene Privilegien (Was bedeutet es, ein weißer Mann zu sein?) und hinterfragt bestehende Strukturen. Dabei holt sich Biewen Hilfe von Co-Host Chenjerai Kumanyika. Auch die Geschichte und Entstehung von Rassismus wird hier thematisiert.
Anmerkung: Dieser Podcast wurde vom Center for Documentary Studies der Duke University herausgegeben und ist auf Englisch.

Der Instagram-Kanal @saymyname_bpb ist ein Projekt der Bundeszentrale für politische Bildung und betreibt antirassistische Aufklärungs- und Bildungsarbeit auf Instagram. Auf dem Kanal finden sich unter anderem einige Begriffserklärungen aus dem Kontext der Antirassismus-Arbeit ("Was bedeutet marginalisiert sein?", Was ist Whataboutism?") sowie Zitate, Bilder und Videos von und mit Aktivisten und Antirassismus-Trainern.
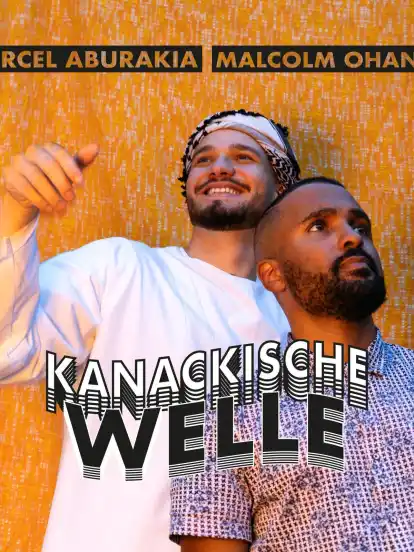
"Kanackische Welle" ist ein Podcast von Malcolm Ohanwe und Marcel Aburakia. Die beiden Münchener Journalisten haben jeweils ein palästinensisches Elternteil und besprechen in ihrem Podcast verschiedene Themen wie Rassismus, Popkultur oder Sexualität aus einer post-migrantischen Sicht.
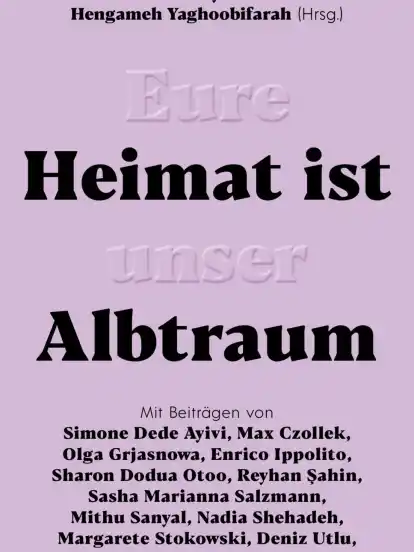
Wie fühlt es sich an, tagtäglich als „Bedrohung“ wahrgenommen zu werden? Wie viel Vertrauen besteht nach dem NSU-Skandal noch in die Sicherheitsbehörden? Was bedeutet es, sich bei jeder Krise im Namen des gesamten Heimatlandes oder der Religionszugehörigkeit der Eltern rechtfertigen zu müssen? Und wie wirkt sich Rassismus auf die Sexualität aus? - "Eure Heimat ist unser Albtraum" behandelt in 14 Essays von verschiedenen Autorinnen und Autoren in Form von Gesellschaftskritiken Fragen rund um Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und andere Formen von Diskriminierung in Deutschland.
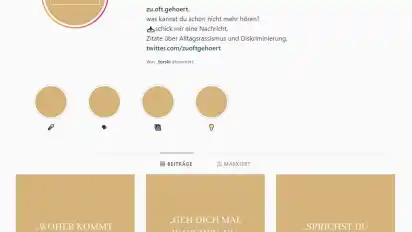
Der Instagram-Account @zu.oft.gehoert ist einer von vielen Accounts, die sich auf konkrete Beispiele für Alltagsrassismus fokussieren. In jedem Beitrag wird jeweils eine Aussage oder Frage zitiert, die nicht-weiße Menschen häufig hören. Darunter fragen wie "Woher kommst du?" oder "Seit wann lebst du hier?"

In ihrem Deezer-Podcast "Maschallah!" spricht die Journalistin Merve Kayikci mit unterschiedlichen deutschen Muslimen über ihr Leben in Deutschland, über die Erwartungen anderer Menschen und eigene Ziele. Ihr Ziel: Der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft das Stereotyp "Muslim" ausreden und stattdessen zeigen: Muslime sind vielfältig und gehören zu Deutschland. Gerade ist zudem ihr Podcast "Primamuslima" beim Bayerischen Rundfunk angelaufen.
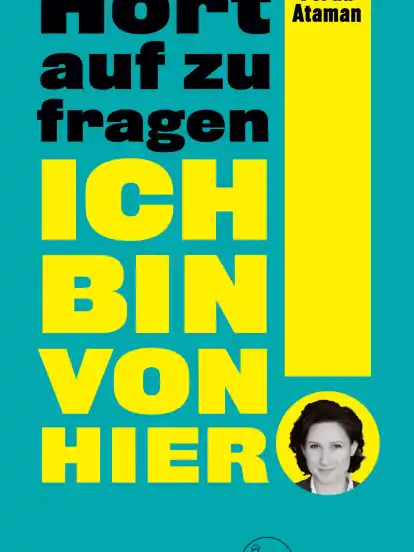
"Ich bin von hier" von der Journalistin Ferda Ataman, ist ein Plädoyer dafür, die eigene Wahrnehmung zu hinterfragen und zu ändern. Ataman schreibt aus Sicht einer Deutschen, die häufig nicht als deutsch wahrgenommen wird - aufgrund ihres türkischen Namens. Das Buch handelt von Identität, Zugehörigkeit und öffentlichen Debatten zum Thema Migration.
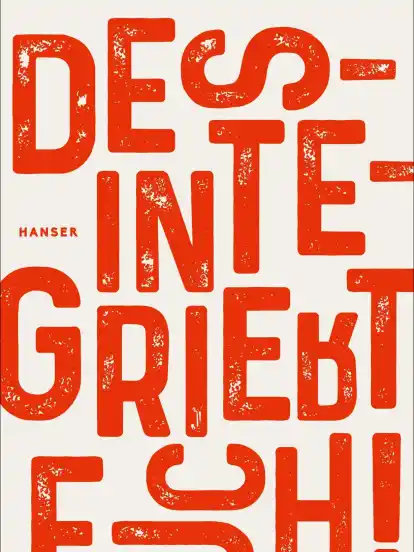
Der Essay "Desintegriert euch" von Max Czollek, dekonstruiert das Konzept Integration aus jüdischer Perspektive und hinterfragt das dahinterstehende Paradigma, das Integration häufig als einseitige Aufgabe von nur einer Gruppe begreift. Dabei geht es auch um den Kern von Rassismus: das Andersmachen von Menschen.

In ihrem Podcast "Chai Society" sprechen die beiden Bremerinnen Refiye Ellek und Soraya Jamal von Bremen Next über die Themen einer jungen deutschen BIPOC-Community (Black, Indigenous, and People of Colour). Lernen kann man dort so Einiges: Vor allem, dass Deutschland vielfältig ist.
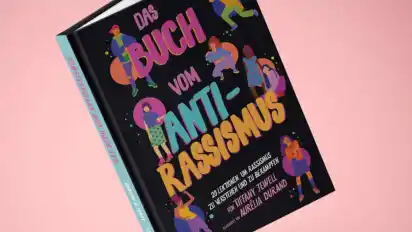
"Das Buch vom Antirassismus" erklärt Heranwachsenden von 10 bis 17 Jahren die Ursprünge von Rassismus, welche Rolle sie dabei einnehmen und was sie dagegen tun können. In den USA war das Buch zwischenzeitlich auf Platz eins der New York Times Bestseller-Liste und wurde auch im berühmten Buchklub der Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey vorgestellt. Am 31. August 2020 erscheint es im Zuckersüß Verlag auch auf Deutsch.
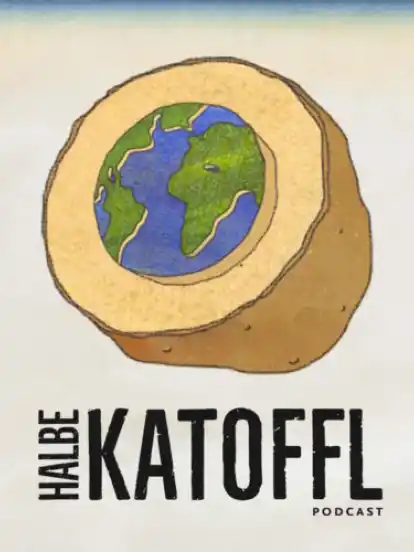
Der Podcast "Halbe Katoffl" ist eine Gesprächsreihe mit Deutschen, die keine deutschen Wurzeln haben. Es geht darin um ihr Leben, ihre Erfahrungen, die Vor- und Nachteile von einem Leben zwischen zwei Kulturen. Immer wieder geht es darin auch (zwischen den Zeilen) um Rassismus. Gründer und Moderator des Podcasts ist der Berliner Journalist Frank Joung. In seinem Podcast spricht er mitunter auch mit sehr bekannten Persönlichkeiten wie Samy Deluxe.