Geht es um die Frage, woher das Fleisch fürs Schnitzel oder die Frikadelle kommt, dann sehen und hören viele lieber weg. Das Thema Schlachten sei inzwischen ein Tabu, sagt Wolfgang Golasowski. "Wir wollen alle regionale Lebensmittel kaufen, aber wie das Fleisch von der Weide auf den Teller kommt, das wollen wir lieber ausblenden", sagt der ehemalige Bremer Staatsrat. Woran das liege? "Zu blutig, zu natürlich, zu nahe dran."
Golasowski ist Sprecher von 36 Landwirtinnen und Landwirten im Elbe-Weser-Dreieck, die den Ruf der Fleischproduktion verbessern wollen, indem sie selbst einiges anders machen, als es bisher üblich ist. Sie alle versorgen kleine Herden und vermarkten das Fleisch meist direkt in ihren Hofläden. Auch bei der Schlachtung der Tiere wollen sie einen anderen Weg einschlagen, sagt der Blocklander Landwirt Jan Eike Geerken. "Es ist schade, dass es in der Region keine kleinen Schlachthöfe mehr gibt", findet der Chef des Bio-Hofs Geerken-Hemmlisch. Der Wunsch nach mehr Tierwohl und einer guten Fleischqualität hätten die Landwirte veranlasst, sich zusammenzuschließen, um sich für eine hofnahe Schlachtung einzusetzen.
Auch Anja Schumacher vom gleichnamigen Biohof in Borgfeld ist dabei. Vor ein paar Jahren hat die Hofladenbetreiberin eine Initiative mitgegründet, die "Regional-Weidefleisch GbR", die sich unter anderem dafür einsetzt, dass Tiere in kleinen Betrieben auf dem Hof getötet werden, um später auf kleinen Schlachthöfen weiterverarbeitet werden zu können. Das habe Vorteile: "Die Tiere sterben in vertrauter Umgebung und stressige Transportwege bleiben ihnen erspart", sagt die Borgfelderin.
Trotz bestehender gesetzlicher Grundlagen seien die Voraussetzungen für eine Umsetzung jedoch schwierig. Die sogenannte Hoftötung und die Weidetötung seien in der Schweiz zwar seit Juli 2020 und in der EU seit März 2021 erlaubt. Doch die Regelungen seien kompliziert und mit hohen Hürden belegt. Das wollen die Landwirtinnen und Landwirte ändern.
Belastung für die Tiere
"Der Transport zum Schlachthof ist für Nutztiere oft sehr belastend", erklärt Anja Schumacher. Auch die Zeit bis zur Tötung sei für die Tiere oft mit Stress verbunden. Eine vergleichende Studie des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (Fibl) zeige, dass Hoftötungen den Stress der Tiere erheblich verringern können. "Die Tiere kennen den Stall oder die gewohnte Umgebung auf der Weide", ergänzt Jan Eike Geerken.
180 Tiere versorgt der Landwirt auf seinem Hof im Blockland. Um einen Termin in einem Schlachthof zu bekommen, müsse er oft lange warten. Es gebe nur wenige Schlachthöfe, die kleine Mengen verarbeiten würden. "Ich schlachte in der Regel ja nur ein Tier", sagt der Landwirt. "Und ich will auch nur mein Tier aus dem Schlachthof zurückhaben, um es dann in meinem Laden zu verkaufen."
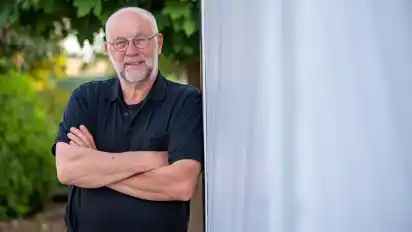
Wolfgang Golasowski ist Sprecher der Regional-Weidefleisch GbR.
Wolfgang Golasowski spricht von einem Nadelöhr: "Viele kleine Schlachthöfe in der Region wurden geschlossen – zu wenig Personal, zu unrentabel, zu hohe Hürden bei der Zulassung." Man wolle die Politik davon überzeugen, dass es eine Unterstützung für kleine Betriebe und Direktvermarkter sei, die Voraussetzungen für eine Tötung der Tiere auf dem Hof und eine Infrastruktur kleinerer Schlachthöfe zu schaffen.
Trotz vieler Vorzüge sei die hofnahe Schlachtung bis in die 2010er-Jahre hinein rechtlich verboten gewesen – oder nur in Ausnahmefällen zulässig. "Nämlich nur dann, wenn das Tier wegen eines Unfalls nicht mehr zum Schlachthof transportiert werden konnte oder wenn es ausschließlich für den privaten Haushalt des Erzeugerbetriebes geschlachtet wurde." Alle anderen Tiere mussten lebend in eine zugelassene Schlachtstätte transportiert und dort geschlachtet werden. Hauptgrund dafür waren die hygienischen Bedingungen, die auf einem Schlachthof besser einzuhalten seien als in einem Stall oder auf der Weide, hieß es.
2011 habe der Gesetzgeber die Regelung dann ein Stück weit gelockert. Als Alternative zur herkömmlichen Schlachtung im Schlachtbetrieb wurde in Deutschland die sogenannte Weideschlachtung erlaubt – allerdings nur für Rinder, die ganzjährig im Freien leben.
Voraussetzungen gut – Umsetzung schwierig
Vor zwei Jahren teilte das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) dann mit, dass es den Ausbau von Weide- und Hofschlachtungen im Rahmen eines Programms zur Innovationsförderung unterstützen wolle. Wie so etwas zeitnah im Elbe-Weser-Raum umgesetzt werden könne, wollen die Landwirte im Elbe-Weser-Raum laut Golasowski zukünftig mit der niedersächsischen Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte und der Bremer Landwirtschaftssenatorin Kathrin Moosdorf (beide Grüne) diskutieren.
Ein Treffen in Hannover mit Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte habe bereits erste Hürden aus dem Weg geräumt. Allerdings sei der Weg steinig, sagt Golasowski: "Ich habe schon einige Landräte im Landkreis Diepholz und Verden gefragt, ob sie die Inbetriebnahme kleinerer Schlachthöfe unterstützen wollen – alle finden die Idee gut." Es traue sich nur kaum jemand ran.





