„Viele gute Arbeiten waren dabei“, sagt Stephan Leupold, Leiter des Jugend forscht-Regionalwettbewerbs Bremen-Mitte. Die Juroren hätten eine sehr gute Arbeit geleistet und davon lebe auch der Wettbewerb: „Die Arbeiten einer hochprofessionellen Jury zu präsentieren. Das ist die Wertschätzung, die Jugend forscht hineinbringt.“
Wobei der Wettbewerb auch in diesem Jahr wieder unter erschwerten Bedingungen veranstaltet wurde. Wie bereits im vergangenen Jahr, so wurden die Arbeiten auch dieses Mal online präsentiert und durch die Jury bewertet. Zwar sagt Stephan Leupold: „Das hat gut funktioniert, da merkt man, dass Onlineunterricht nichts Neues mehr ist“. Doch insgesamt gehe im zweiten Jahr der Pandemie den Schulen etwas die Luft aus, was die Unterrichtsversorgung angeht: Der Krankenstand sei hoch, Studierende seien nicht so verfügbar wie sonst und dazu auch noch die Pandemieverordnung, die eine Mischung der Kohorten untersagt.
Expertengespräche fehlen
Angemeldet gewesen seien 180 Arbeiten, abgegeben worden seien 102, was der Pandemie geschuldet sei, weil viele Arbeiten in der Schule betreut werden würden. Und doch versuchen die Veranstalter des Wettbewerbs, möglichst wertschätzend zu arbeiten, wobei Leupold auch sagt: „Videoübertragungen können keine Wettbewerbsatmosphäre hervorrufen. Während des Wettbewerbs im Universum entwickeln sich sonst Expertengespräche, man sieht die anderen Arbeiten. Das fehlt.“
Eine Expertin auf ihrem Gebiet ist Lisa Jandeck aus Horn-Lehe. Die Schülerin des Kippenberg-Gymnasiums hat sich mit Forschungsansätzen zur Herstellung eines konkurrenzfähigen Ersatzprodukts für Palmöl beschäftigt. „Ich habe eine schlimme Dokumentation über das Thema gesehen. Dort haben Menschen ohne Schutz Pflanzen mit Pestiziden eingesprüht, und Kinder haben auf den Palmölplantagen gearbeitet. Nur, damit wir Schokocreme und Waschmittel haben“, empört sich die 15-Jährige, „und dagegen wollte ich etwas tun“.
Süßlupinen statt Palmöl
Sie hat sich mit Fetten und Ölen beschäftigt und Palmöl näher untersucht. „Fette wie Sonnenblumenöl oder Rapsöl haben die gleichen Bestandteile, nur in anderen Mengenverhältnissen“, erzählt sie. Das Palmöl mit seinen Mengenverhältnissen sei für die Lebensmittelindustrie attraktiver, weil es dadurch geschmeidiger werde, und diese Eigenschaft wollte sie mit anderen Fetten ebenfalls erreichen. „Ich wollte zu den bestehenden Ölen andere Bestandteile dazu mischen und es so machen, dass es preiswert bleibt, damit die Industrie das auch einsetzt.“ Das Ergebnis: „Ich habe Süßlupinen zu Rapsöl gemischt, und das hatte eine ähnliche Konsistenz, einen ähnlichen Geschmack und einen ähnlichen Geruch.“ Daraus hat sie dann Schokocreme gemacht. „Ich habe das Rezept der Schokocreme genommen und lediglich das Palmöl ersetzt, und die Industrie könnte die Produktion ebenfalls umstellen“, ist sie überzeugt.
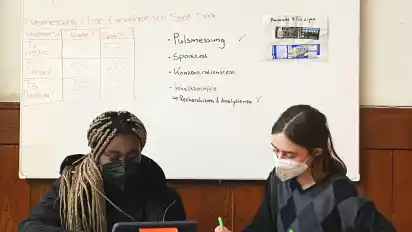
Victoria Boadu (links) und Marietta Barth haben zu Sportgetränken geforscht.
Ob Schokocremes sportlich sind, darüber lässt sich streiten, ob Sportdrinks sportlich sind, auch: Marietta Barth und Victoria Boadu vom Hermann-Böse-Gymnasium haben sich jedoch nicht darüber gestritten, sondern gemeinsam geforscht. Sind diese Getränke so gut, wie behauptet wird und lohnt es sich, sie zu trinken? Dazu haben sie verschiedene Tests mit Freiwilligen durchgeführt: Pulsmessungen, Konzentrationsübungen und Sporttests. Das Ergebnis: Bei zwei von vier Probanden war der Puls nach dem Trinken erhöht, die Konzentration war jedoch bei allen Teilnehmenden verbessert.
Machen Sportdrinks sportlich?
Beim Sporttest konnte bei zwei Teilnehmenden eine Steigerung beobachtet werden. Das Fazit: „Das Schlimme dabei ist der Zucker im Getränk“, sagt die in der Östlichen Vorstadt lebende Marietta, „eine Flasche hat 20,5 Gramm Zucker. Und es wird mit dem Vitamin B6 geworben, doch das kann man auch mit Bananen erreichen“. Zudem sei der Zucker Industriezucker, der den Insulinspiegel ansteigen lasse, sagt die Vahrerin Victoria. „Bei regelmäßiger Einnahme kann es also schädlich sein.“ Als Alternativen nennen die beiden 14 Jahre alten Schülerinnen Saftschorlen. „Die haben den gleichen elektrolytischen Effekt, haben Vitamine und löschen den Durst“, sagt Marietta. „Und Fruchtzucker ist nicht so schädlich wie Industriezucker.“
Das Phänomens des Grund- und Obertonhörens ist der Schwerpunkt der Forschungen bei Lotte Rating aus Findorff und Daria Schlumbohm aus dem Viertel vom Alten Gymnasium. Zwei bestimmte Töne, direkt hintereinander abgespielt, werden von einigen Menschen höher, von anderen tiefer wahrgenommen, was daran liegt, dass Menschen Grund- und Obertöne unterschiedlich wahrnehmen.
Tests mit 166 Probanden
Dazu haben die 16 Jahre alten Schülerinnen Tests an 166 Probanden zwischen zehn und über 70 Jahren vorgenommen, wobei die Gruppe mit 115 Grundtonhörern am höchsten war. Daneben gab es noch 38 Obertonhörer, die verbliebenen Probanden waren Mischtonhörer. Grundtonhörer bevorzugen dabei Schlagzeug, Gitarre, Klavier, Trompete und hohe Soloinstrumente, Obertonhörer eher Streich-, Blech- und Blasinstrumente und auch Instrumente in tieferen Lagen, wie den Kontrabass. Und eine weitere Frage der beiden lautete: Inwieweit verändert sich die Wahrscheinlichkeit, im Alter ein Grundtonhörer zu sein? Zumindest einen Zusammenhang mit der Altersschwerhörigkeit konnten sie nicht eindeutig beantworten, ob im Alter eher Grundtonhörende zu finden sind. „Und auch einen Altersunterschied konnten wir nicht feststellen“, sagt Lotte.





