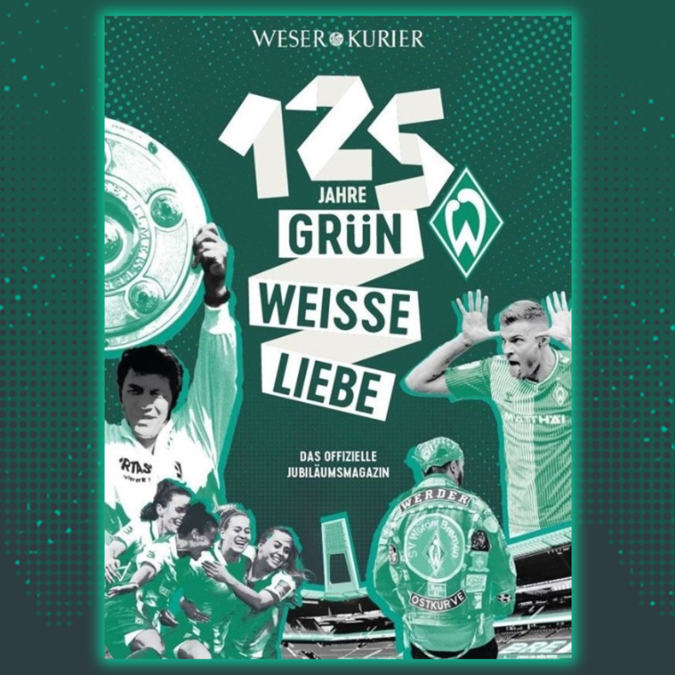“Das war ein Propaganda-Denkmal”, sagt Gudrun Eickelberg vom Verein "Der Elefant".
Zehn Meter ist das Monument aus rotem Backstein hoch. Hinter dem Hauptbahnhof steht es, zwischen Bürgerweide und Herman-Böse-Gymnasium. Der Elefant ist stadtbekannt. In den 1920er-Jahren sprachen sich viele Bremer Handelsfirmen dafür aus, die deutschen Kolonien zurückzugewinnen. Der 1931 errichtete Elefant sollte das öffentlichkeitswirksam unterstützen. Auftraggeber war die Deutsche Kolonialgesellschaft. Der Bau war in Bremen umstritten, doch vor allem nationale Kräfte unterstützten die Errichtung des Backsteinmonuments.
Das machten sich auch die Nationalsozialisten zu nutzen: Bremen sollte als "Stadt der Kolonien" wieder den Imperialismus heraufbeschwören, die Kolonien, die das Deutsche Reich nach dem Ersten Weltkrieg wieder abgeben musste.
Wirklich profitabel waren die Kolonien nie gewesen. Besonders die blutigen Kämpfe in Deutsch-Südwestafrika und Deutsch-Ostafrika, heute Namibia und Tansania, hatten immense Kosten verursacht. Viele begeisterten sich erst für die Kolonien, als sie nicht mehr Teil des Deutschen Reichs waren – daran konnte Hitler anknüpfen.

Aus dem Ehrenmal für den Kolonialismus ist ein Antikolonialdenkmal geworden, in dem regelmäßig Veranstaltungen stattfinden.
Heute ist die Statue ein Antikolonialdenkmal und ein Ort für kulturelle Veranstaltungen. In unmittelbarer Nähe hat Bremen 2009 einen Steinkreis errichtet als Erinnerung an die Opfer Herero und Nama während des Krieges der deutschen Kolonialmacht in Namibia – seit dem vergangenen Jahr von Deutschland als Völkermord anerkannt.
Warum Bremen anderen Städten gegenüber einen Vorteil in der Erinnerungskultur hat und wie es im Inneren des Denkmals aussieht, gibt es im Video mit Gudrun Eickelberg vom Verein "Der Elefant" zu sehen.