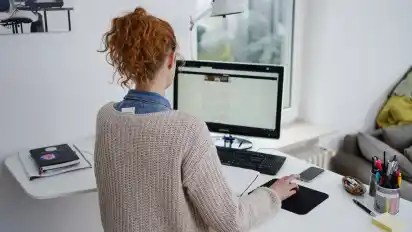In der Deutschland-Zentrale des Milka-Herstellers Mondelez gab es schon vor der Pandemie die Möglichkeit des flexiblen Arbeitens. Sofern es das Projekt zuließ, konnten die Beschäftigten von daheim aus arbeiten. Vor fast vier Jahren zog das Unternehmen dann aus der Neustadt in die Überseestadt. Eine Arbeitsgruppe, zu der auch eine Reihe von Beschäftigten gehörte, machte sich Gedanken, wie die neuen Arbeitsplätze organisiert sein sollten. Bereits damals hieß der Trend „New Work“, also „neue Arbeitsformen“. Dabei geht es um das Aufbrechen von bisher starren Abläufen und auch alten Hierarchien.
Bei Mondelez ging es vor dem Umzug auch darum, ob man wie am alten Standort weiterhin Großraumbüros haben sollte. Die Antwort lautete „Ja“. Zu dem Zeitpunkt war es bereits ein beliebter Trend, dass Beschäftigte sich in der Firma dort hinsetzen sollen, wo Platz ist. Doch Mondelez behielt auch nach dem Umzug die festen Schreibtische bei – damit die Mitarbeiter auch im Betrieb irgendwo eine feste Heimat haben.
Großraum statt Einzelbüro
Experten gehen aber davon aus, dass die Pandemie den Schritt zum Modell des „shared desk“, der aus den USA kommt, noch stärker nach Deutschland bringen wird: Einzelbüros werden zu Großraumbüros. Dass auf der einen Seite der Wunsch der Beschäftigten vorhanden ist, auch nach der Pandemie weiterhin im Homeoffice arbeiten zu können, zeigt eine Befragung die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Baua) von 2020, die nun veröffentlicht wurde: „Unter den großen Betrieben mit mehr als 250 Beschäftigten wollten über 50 Prozent das Home Office ausbauen“, sagt Nils Backhaus, Fachmann für Arbeitsorganisation. „Da drei Viertel der Beschäftigten in großen Betrieben arbeiten, wird das doch sehr viele Menschen betreffen.“
Das bringt die Unternehmen zum Umdenken. Sie überlegen, wie viele Büroarbeitsplätze sie eigentlich noch brauchen. „Die wenigsten Beschäftigten wollen hundert Prozent Homeoffice“, sagt Backhaus. Die Organisation hybrider Arbeitszeitmodelle mit dauerndem Wechsel zwischen Arbeit im Betrieb und Zuhause werde eine große Herausforderung für die Unternehmen: „Da kommt den Betriebsräten und Beschäftigten eine große Rolle in der Mitbestimmung zu.“
"Beschäftigte mitbestimmen lassen"
Bei Mondelez konnten die Beschäftigten mitbestimmen, wie die Arbeit in der neuen Firmenzentrale aussehen soll. Die Mitarbeiter dabei zu beteiligen, und das bereits von Anfang an, sei der beste Schritt, sagt Hannah Schade vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund. Im Gespräch mit dem WESER-KURIER berichtet sie von einem Negativbeispiel: „Da hatte der Arbeitgeber den Beschäftigten das Homeoffice zugesagt. Allerdings wurde den Beschäftigten nicht gesagt, dass sie damit im Unternehmen den Anspruch auf einen festen Büroarbeitsplatz verloren haben."
„Spitz auf Knopf kalkulierte Büros scheinen mir verführerisch für den Arbeitgeber, der denkt, das wird günstiger für mich“, sagt Schade. „Doch eine Umstellung, die allen etwas bringt – auch dem Arbeitgeber durch gesteigerte längerfristige Produktivität und höhere Zufriedenheit der Arbeitnehmer – die ist nicht günstig“, sagt die Wissenschaftlerin. „Also keine Mini-Telefonboxen, in denen man das Gefühl hat, keine Luft zu bekommen. Sondern verschiedene Arten von Räumen für verschiedene Tätigkeiten und genug Platz für alle Tätigkeiten, die die Mitarbeiter ausüben.“
Flexi-Büros als Forschungsgegenstand
Zu "Flexi-Büros" gibt es nach Schades Worten noch keine größer angelegten wissenschaftlichen Studien. Bereits ziemlich gründlich untersucht sind dagegen die üblichen Großraumbüros. Demnach sind diese der Produktivität und der Kommunikation eher abträglich. „Man kann mit Großraumbüros Platz sparen, aber mit einer Produktivitätssteigerung kann man nicht rechnen", sagt Schade. "Insbesondere dann nicht, wenn die Leute das Gefühl haben, dass sie beobachtet werden."
Als zweifelsfrei erwiesen gilt, dass ein hoher Geräuschpegel im Büro Stress bedeutet. Dementsprechend werden Großraum-Belegschaften angehalten, möglichst geräuschlos zu arbeiten. Im Ergebnis leidet dann die Kommunikation: Für eine 2018 erschienene britische Studie bauten die Wissenschaftler die Trennwände in Büros aus. Ergebnis: Die Zahl der Gespräche von Mensch zu Mensch sank um 70 Prozent.
Nicht jede Arbeit geht von daheim aus
Mondelez-Sprecherin Jenny Linnemann sagt: „Bereits an unserem alten Standort haben wir in Großraumbüros gearbeitet und entsprechend eine lange Erfahrung damit. Nach dem Umzug in die Überseestadt war dies deshalb für unsere Mitarbeitenden nicht neu. Auch die Geschäftsführung arbeitet im Großraumbüro.“
Eine ganze Reihe von Dingen lasse sich ebenso gut im mobilen Arbeiten erledigen. „Viele Kolleginnen und Kollegen schätzen es sehr, dass sie sich die Arbeit flexibel einteilen können und zwischendurch zum Beispiel die Kinder von der Schule abholen können“, stellt Linnemann fest. Wissenschaftlerin Hannah Schade sagt, dass mit der Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort die Zufriedenheit steige. Doch alles von daheim aus zu erledigen gehe eben auch nicht, wie Linnemann abschließend sagt: „Wir schauen mit einer abteilungsübergreifenden Arbeitsgruppe, was beim hybriden Arbeiten gut funktioniert, und bei welcher Arbeit man besser gemeinsam im Büro sein sollte, um sich dort zu begegnen.“