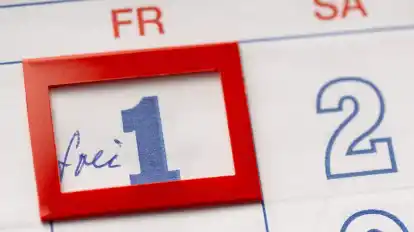Im vergangenen Jahr schrumpfte hierzulande die Wirtschaft. Was bedeutet das eigentlich?
Torben Klarl: Volkswirtschaften wie Deutschland oder auch die USA wachsen seit Längerem nicht mehr so stark. Das hat vor allem damit zu tun, dass wir schon recht gesättigt sind – gerade im Bereich von materiellen Gütern. Denken Sie beispielsweise an den Fernseher. Wenn Sie 1960 einen Fernseher gekauft haben, war der relativ teuer bei schlechter Qualität. Der technische Fortschritt hat die Geräte im Verhältnis deutlich billiger gemacht.
So können ihn sich mehr Menschen leisten. Führt das nicht zu Wachstum?
Die günstigen Preise haben einen Effekt: Sie können mehr von Ihrem Einkommen für Dienstleistungen ausgeben – für Reisen oder Restaurants. Dienstleistungen haben darum heute eine größere Bedeutung für die Wirtschaft. Allerdings gibt es hier kein exponentielles Wachstum. Es kommt noch ein zweiter Grund dazu, warum das Bruttoinlandsprodukt nicht mehr so stark wächst: Unsere Gesellschaft wird älter.
Inwiefern drückt das aufs Wachstum?
Wenn die Geburtenraten zurückgehen, kommen weniger Menschen nach, die produktiv arbeiten und neue Ideen entwickeln. Das bremst unseren Fortschritt. Das Wirtschaftswachstum nimmt nicht mehr so stark zu wie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals gab es in Deutschland höhere Geburtenraten als heute. Wir waren im Vergleich aber relativ arm.
Als "Wirtschaftswunder" ging der Aufschwung in die Geschichte ein. Was hat es für Folgen, wenn die Wirtschaftsleistung aber kaum noch wächst?
Wir sind heute ein reiches Land. Das Wirtschaftswachstum spielt deshalb gar nicht mehr die ausschlaggebende Rolle. Das ist in relativ armen Volkswirtschaften ganz anders. Wir können uns sicher erlauben, ein bisschen fauler zu sein. Das machen Innovationen möglich. Wir wachsen zwar noch, aber nicht mehr so deutlich. Für Politiker ist das Wirtschaftswachstum dennoch natürlich ein wichtiger Indikator.

Torben Klarl ist an der Universität Bremen Professor für Volkswirtschaftslehre – insbesondere Makroökonomie.
Wir haben also insgesamt als Gesellschaft gewissen Reichtum erzielt, weshalb wir uns ums Wachstum weniger sorgen sollten?
Genau. Pointiert könnte man sagen: Die stagnierende Wirtschaft ist ein Zeichen unseres Erfolgs. Die Sache ist natürlich, dass deshalb der Kuchen für alle nicht mehr so stark wächst. Das führt zu Verteilungskämpfen – und die müssen wir ausfechten. Das lässt sich jetzt schon sehen. Politiker müssen auf Gruppen zugehen und sagen: Ihr bekommt ein kleineres Kuchenstück. Die Frage ist: Wo möchte man lieber leben? In einer relativ armen Gesellschaft mit hohen Wachstumsraten oder in einer reichen Gesellschaft, wo Wachstumsgewinne an Bedeutung verloren haben.
In Bremen ging die Wirtschaftsleistung sogar etwas stärker zurück. Hier sank das BIP nach Angaben des Statistischen Landesamts preisbereinigt um 0,6 Prozent. Was heißt das?
Natürlich brechen damit vor allem Steuereinnahmen weg, die für das Gesundheitswesen, die Bildung und Infrastruktur fehlen. Die Bildung in Bremen ist sowieso stark unterfinanziert. Dabei gefährden die Auswirkungen einer schlechten Bildung den Wohlstand einer Gesellschaft. Humankapital – ein ökonomischer Begriff, den nicht jeder so gerne hört – ist ein relevanter Treiber für Wachstum. Wir haben in Deutschland keine anderen Ressourcen. Da ist es schon verwunderlich, dass Bildung nicht die zentrale Rolle spielt.
In Bremen soll ein Ausbildungsfonds helfen, damit junge Menschen gut ins Berufsleben starten und Unternehmen Nachwuchs finden. Wie finden Sie die Idee?
Ich sehe das kritisch. Die Ausbildungsabgabe verursacht erst mal Bürokratie. Aber genau das bremst doch unser Wachstum. Ob der Nutzen die Erhebungskosten überwiegt, ist fraglich. Die Idee hat übrigens schon Gerhard Schröder (SPD) als Bundeskanzler ins Gespräch gebracht.
Erinnern Sie sich? Wie standen Experten damals dazu?
Von Ökonomen war unisono Ablehnung zu hören. In Bremen wird die Ausbildungsabgabe anhand der Bruttolohnsumme errechnet. Es ist schon sehr gewagt, die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens anhand dieses Kriteriums zu bemessen. Wenn ein Unternehmen nicht einstellen kann, weil es die Lage nicht hergibt, wird es noch bestraft – obwohl es vielleicht ausbilden möchte.
Die Frage nach der Arbeitszeit ist ein heißes Thema. Gilt da genauso: Wir können ein bisschen fauler sein?
Das ist ein wichtiges und spannendes Thema. Stellen wir uns vor: Wenn wir jetzt alle weniger arbeiten, werden Güter und Dienstleistungen knapper. Kurzfristig ist das ein Problem und führt zur Inflation. Über höhere Preise können die Unternehmen höhere Löhne bieten und Menschen in Arbeit locken. Damit steigt das Güterangebot wieder und nimmt den Preisdruck. Das regelt also der Markt über Anreize. Der Tarifabschluss bei der Bahn zeigt, dass die Menschen sich flexiblere Arbeitszeitmodelle wünschen: Man kann mehr arbeiten – aber auch weniger. Das ist genau der Punkt. Ich glaube, da geht die Reise hin. Unternehmen müssen hier innovativer werden.
Für einige passen Ideen wie die Viertagewoche nicht in die Zeit – nicht nur wegen des Fachkräftemangels. Viele sorgen sich grundsätzlich um die Attraktivität des Standorts Deutschland.
Die Entscheidungen der Bundesregierung haben in letzter Zeit für gewisse Unsicherheiten gesorgt. Das ist für Unternehmen Gift, die Firmen zweifeln an ihren Investitionen, weil sie nicht wissen, wohin die Reise geht. Das ist natürlich ein Problem. Wir brauchen eine Strategie insbesondere zur Transformation: Wo wollen wir eigentlich hin? Darauf kann sich die Politik aber gerade nur schwer einigen.
Andere Stimmen sagen zugleich: Die Lage ist viel besser als die Stimmung. Ist da was dran?
Man sollte immer die Kirche im Dorf lassen und sich ganz nüchtern mit Zahlen und Fakten auseinandersetzen. Wir haben Herausforderungen in Deutschland, sind damit aber nicht allein. Wir haben eine gute Wissenschaft im Land und innovative Unternehmen. Wir müssen es schaffen, unsere Potenziale noch besser zu nutzen – insbesondere im Bereich der neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz. Wir müssen diese zukunftsorientierten Schlüsselindustrien fördern. Das ist in der Vergangenheit ziemlich viel schiefgelaufen – auch auf EU-Ebene. Ideen führen zu Wachstum und Wohlstand. Das ist die treibende Kraft.
Das Gespräch führte Lisa Schröder.