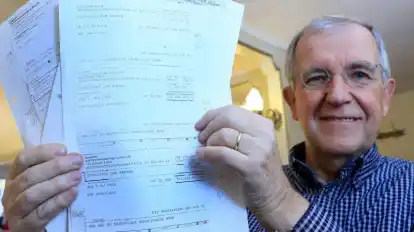Frau Linnert, wann ist Ihnen die schwierige finanzielle Lage Bremens eigentlich bewusst geworden?
Karoline Linnert: Ich bin 1979 nach Bremen gezogen, von da an war mir die Lage natürlich bekannt. Ich war schon bei den Grünen, da wurde zu dieser Zeit selbstredend auch viel über dieses Thema diskutiert. Es hat den politischen Alltag bestimmt.
Finanzpolitikerin waren Sie aber noch nicht.
Nein, ich war Sozialpolitikerin und habe mir ständig von älteren Herren anhören müssen, dass für sozialpolitische Projekte kein Geld da sei. Und weil ich den Dingen gerne auf den Grund gehe, habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren, wofür das Geld denn da ist und wofür es an anderer Stelle gebraucht wird. Finanzpolitik bietet eine große Chance für einen politischen Diskurs auf der Basis gemeinsamer Fakten. Die Zahlen stimmen oder sie stimmen nicht. Es gibt quasi keine weichen Faktoren, das hat für die politische Auseinandersetzung großen Reiz.
Finanzpolitik war allerdings zunächst kein zentrales grünes Politikfeld, auch nicht in Bremen.
Das stimmt. Aber gerade in den Jahren der Großen Koalition spielte die Finanzpolitik eine wahnsinnig wichtige Rolle, und wir haben in diesem Bereich viel dazugelernt. Wir haben uns reingekniet und nicht locker gelassen.
Als finanzpolitische Sprecherin der Grünen waren Sie scharfe Kritikerin der Finanzpolitik der Großen Koalition. Geradezu gebetsmühlenartig forderten Sie Haushaltswahrheit und -klarheit ein, die Abschaffung von Schattenhaushalten und von Wechseln auf die Zukunft. Da ahnten Sie noch nicht, dass sie selbst einmal das Finanzressort verantworten würden. Können Sie sich im Amt an Ihren Worten messen lassen?
Ich habe geändert, was ich konnte. Es gibt immer noch Sondervermögen, das hat mir die Opposition in der jüngsten Haushaltsdebatte auch vorgehalten. Ich habe sie nicht installiert, und ich habe in der Debatte auch nicht gehört, wie wir sie abbauen können, ohne uns zu ruinieren. Aber es hat sich viel verändert. Die Kontrolle wurde verbessert, und Sondervermögen können keine Kredite mehr aufnehmen.
Sie bekommen Geld aus dem Haushalt, das ist transparenter. In unserer Finanzplanung kann man die gesamte Investitionstätigkeit des Staates sehen, die Gehälter der Geschäftsführer unserer Gesellschaften werden veröffentlicht. Das alles gab es vor zehn Jahren nicht. Das habe ich erkämpft, und das war nicht leicht, weil man den Einfluss anderer beschneiden musste.
Wessen Einfluss?
Den der mächtigen investierenden Ämter, Abteilungen und Senatsressorts, die es gewohnt waren, pauschal Geld zugewiesen zu bekommen und im Laufe des Jahres festzulegen, welches der beschlossenen Projekte daraus finanziert wird. Jetzt liegt die Steuerungsmacht wieder da, wo sie sein muss, beim Parlament als Haushaltsgesetzgeber.
In die Geschichtsbücher werden Sie damit vermutlich nicht eingehen, aber als die Finanzsenatorin, die dafür gesorgt hat, dass die Schulden nicht weiter steigen.
Ich mache das hier nicht, damit mir irgendwann irgendwer einen Orden an die Brust heftet. Ich bin Überzeugungstäterin und stehe für eine nachhaltige Finanzpolitik. Wir sind es nachfolgenden Generationen schuldig, dass auch sie Handlungsspielräume vorfinden und nicht von der Schuldenlast erdrückt werden.
Sie hatten bei Ihren Bemühungen auch eine mächtige Hilfe: Die Schuldenbremse hat die Haushaltssanierung erzwungen. Hätten Sie das auch alleine hinbekommen?
Alleine war ich sowieso nicht, das ist schon eine Gesamtleistung von Rot-Grün. Es gibt die gemeinsame Verabredung, entschlossen eine Kehrtwende hinzukriegen. Immer mehr Schulden zu machen war und ist keine Lösung. Obwohl wir eine ganze Menge Kritik aushalten mussten und müssen, aus den eigenen Reihen, von anderen Parteien, in der Bevölkerung, unterwerfen wir uns geschlossen den ziemlich rabiaten Auflagen der Schuldenbremse. Nicht, dass wir uns falsch verstehen: Die Schuldenbremse ist wichtig und richtig. Bremen ist die Blaupause dafür, dass Schulden begrenzt sein müssen. Bei uns kann man sehen, was passiert, wenn ein vernünftiges Maß bei Weitem überschritten worden ist. Ob aber die strengen Auflagen auf Dauer so taugen, wird man sehen müssen.
Inwiefern?
Es ist nicht in jedem Fall falsch, Investitionen über Kredite zu finanzieren. Wenn man das komplett unterbindet, kann man manche Investitionen künftig vergessen. Jede Großinvestition würde zulasten aller anderen Investitionen gehen. Ich weiß nicht, wie man unter diesen Umständen den Sanierungsstau abbauen will, der ja keine Bremensie ist, sondern den es bundesweit gibt. Es wird einen Run auf "Auswegsfinanzierungen“ wie Modelle mit privaten Investoren geben. Da waren wir schon mal, und es hat uns nicht gutgetan. Auf Länderebene wird aktuell diskutiert, wie man mit der Finanzierung großer Investitionsprojekte künftig umgeht.
Die Geschichte Bremens ist auch eine Geschichte der Schulden. Kann dieses Land noch zu einem finanziellen Musterschüler werden wie etwa Bayern?
Die Schulden sind über zwei Generationen aufgetürmt worden, sie verschwinden nicht über Nacht, auch wenn wir ab 2020 im Schnitt jährlich mindestens 80 Millionen Euro Schulden abbauen. Das müssen wir, um die ungeheure Zinslast zu reduzieren. Aber ob man gar keine Schulden mehr haben darf? Den Schuldenberg auf null zu bringen ist jedenfalls nicht mein vorrangiges Ziel. Es gibt in Deutschland keinen Diskurs darüber, wie hoch ein Land verschuldet sein darf. Was ist richtig? Dass wir eines Tages keine Schulden mehr, aber immer noch marode Schulen haben oder dass wir intakte Schulen haben, aber immer noch Schulden? Darüber müssen wir nachdenken und auch darüber, wie weit man gehen kann, ohne dass die Bürger das Vertrauen in den Staat verlieren.