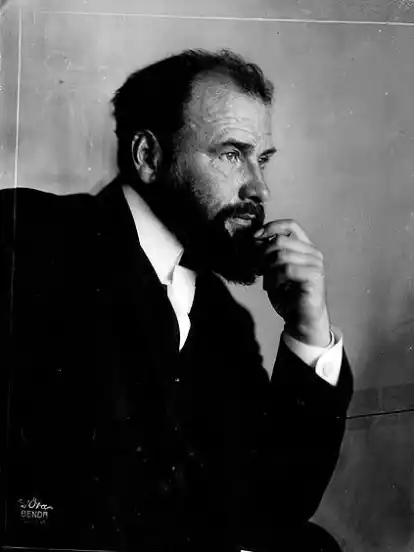Zumal an Wochenenden sind Heranwachsende in der Donau-Metropole so feierfreudig, dass sich von einem Jugend-Stil neuen Typs sprechen lässt. Das ist mehr als ein Kalauer, wie sich immer wieder sonnabends und sonntags in den zahlreichen Museen der Stadt zeigt. Naturgemäß war der Hang der Jugend zum Jugendstil besonders auffällig, als Wien vor drei Jahren den 150. Geburtstag von Gustav Klimt feierte. Damals umlagerte die Jeunesse dorée (vergoldete Jugend; im Klimt-Kontext nicht von ungefähr) die Werke des Künstlers, als seien es Popstar-Devotionalien. Das galt vor allem für das Leopold-Museum, wo im Jubiläumsjahr mit „Klimt persönlich“ die bedeutendste Schau stattfand.
Dass junge Menschen sich auch jenseits der Feierlichkeiten zum 150. Geburtstag an den farbendrallen, sinnenfrohen Bildern sowie an den Selbstauskünften des wirkungsmächtigsten österreichischen Malers weiden, zeugt zum einen davon, wie kunstsinnig die Jugend von heute zumindest in der Hauptstadt des deutschen Anrainerstaates ist. Zum anderen belegt das Interesse der jungen Leute, wie sehr Klimt unser Zeitgenosse ist: Der Mann verstand es wie kaum ein anderer Kulturschaffender, die Grenzen von Kunst und Leben durchlässig zu gestalten, indem er seine Lebens-, Liebes- und Leidenswelt seinem Produktionsprozess oftmals unmittelbar einschrieb.
Beispielhaft ablesbar ist diese Neigung an jenen filigran gestalteten Postkarten mit oft blumigen Motiven, die der Vielreisende den Lieben daheim zukommen ließ. Dabei erstaunt das Missverhältnis zwischen den üppig verzierten Karten und den lakonischen Anschreiben, die ebenso gut von Vertretern der Generation Twitter und SMS hätten verfasst werden können.
Nur bei einer Empfängerin wurde Klimt für seine Verhältnisse nachgerade geschwätzig: bei Emilie Flöge, seinem „Lebensmenschen“. Ihr, der zwölf Jahre älteren Geschäftsfrau, die als avantgardistische Modeschöpferin reüssierte und wohl nur (und immerhin) eine platonische Beziehung mit dem Künstler unterhielt, schickte er bis zu acht Postkarten täglich. Seine drei nachweislichen Kinder (nebst einem knappen Dutzend mutmaßlichen) zeugte Klimt indes mit Gespielinnen, die er konsequent dem Licht der Öffentlichkeit entzog. Bis zuletzt wohnte der manische Schöpfer und verschrobene Privatmann mit dem Hang zum Gesamtkunstwerk bei seiner Mutter und seinen beiden unverheirateten Schwestern. Noch auf dem Sterbebett rief dieser 1918 von einem Schlaganfall gefällte Baum von einem Mann freilich nur nach der einen: Die Midi, so nannte er die Geistesverwandte Emilie Flöge, möge unverzüglich kommen.
Oftmals ist dieser staunenswerte Bildartist auf goldenes Weichspülertum sowie auf kunstpädagogische Vorzeigebetätigungen verkürzt worden. Dabei war Klimt mehr als der Schöpfer des Beethoven-Frieses (zu bewundern im Ausstellungshaus „Wiener Secession“) und des im Oberen Belvedere gezeigten spätromantischen Gemäldes „Der Kuss“, diesem ach so sinnlichen Sinnbild der Innigkeit, dessen Kopien bekanntlich die Schlafzimmer gleich mehrerer Generationen von Europäern zieren.
Spannender ist Klimt als Künstler, der seine Arbeiten sozusagen im Geist des Kollektivismus entwarf. Denn neben seiner engen familiären Verbandelung waren es vor allem intensive, ja intime Arbeitszusammenhänge, die ihn im Wien um 1900 zu einem avantgardistischen und lokalpatriotisch engagierten Künstler qualifizierten. So schrieb sich Klimt mit seinem Bruder Ernst und dem Freund Franz Matsch dem Weichbild der Stadt ein, indem das Trio die Dekoration repräsentativer Ringstraßenbauten übernahm – darunter die des Stiegenhauses im Kunsthistorischen Museum. Im Burgtheater wiederum ist das einzige Selbstporträt des Künstlers zu sehen: auf der erst im Jahr 1998 entdeckten Vorzeichnung zu einer von allerlei anachronistischen Figuren bevölkerten Ansicht des Globe-Theaters in London. Tausendsassa Klimt hätte gewiss gern mehr als nur ein Leben gehabt.