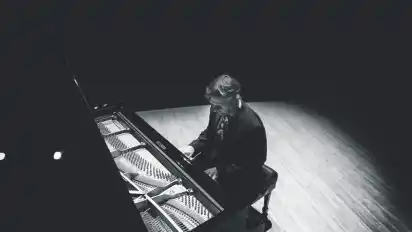Herr Rantala, Sie sind ein hoch gelobter Pianist und außerdem ein faszinierender Komponist. Welchen der beiden Titel mögen Sie lieber?
Iiro Rantala: Ich mag den Titel Musiker, so ganz allgemein.
Das ist ein bisschen sehr allgemein.
Für mich ist auch Bach einfach ein Musiker, wenn man ihn in seiner Zeit betrachtet. Der Begriff Musiker beinhaltet für mich, Musik zu schaffen und zu spielen. Das klingt nicht so hochgestochen. Ich bin zu 50 Prozent Komponist und zu 50 Prozent Pianist. Obwohl: Zurzeit bin ich etwas mehr Komponist wegen meiner zwei Opernprojekte. Die erste Oper hat im nächsten Monat Premiere an der Finnischen Nationaloper in Helsinki, sie heißt „Sanitorio Express“.
Um was geht es?
Sie spielt in einer Blitzheilungsklinik, sehr modern. Man kann sich dort in ein oder zwei Tagen beispielsweise von einer Scheidung erholen. So etwas gibt es wirklich, beispielsweise in der Schweiz. Der Sopran in der Oper will in so einer Klinik eine gescheiterte Ehe hinter sich lassen, bei der Gelegenheit aber auch ein paar Kilo abnehmen – das ist die Ausgangslage. Und dann kommen noch jede Menge neurotischer Menschen hinzu, die alle denken, etwas stimme nicht mit ihnen. Heutzutage denkt ja jeder, er müsse total individuell sein, das ist das Erstrebenswerteste überhaupt. Niemand ist mit sich zufrieden. Die Oper ist eine Farce, ganz klar.
Diese Oper ist fertig, an Ihrer zweiten arbeiten sie noch. Geht es da ähnlich turbulent zu?
Das kann man so sagen, es geht es um Fußball.
Ein ungewöhnliches Sujet. Wie sind sie darauf gekommen?
Ich habe eine sehr gute Librettistin, Minna Lindgren, sie ist Musikjournalistin und Autorin. Und Minna ist ein absoluter Fußballfreak. Wir entwickeln unsere Plots gemeinsam, und wir haben darüber nachgedacht, wie man Fußball, Frauen und Männer kombinieren kann.
Und zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?
In der Oper, die „Equal Game“ heißt, geht es darum, dass das finnische Frauenfußballteam sauer ist, weil Frauenfußball keine Aufmerksamkeit bekommt. Daher wetten die Spielerinnen, dass sie gegen jedes Team der Welt gewinnen können, und dann fordern sie die italienische Nationalmannschaft der Männer heraus. Sie laden die Fußballer nach Finnland ein, und die Oper ist dann das Fußballspiel. Natürlich geht es auch um finnische Frauen und italienische Männer.
Wie setzen Sie das musikalisch um?
Beide Opern sind eine Hommage an die italienische Operntradition, der Einfluss von Donizetti, Rossini, Verdi und Puccini wird zu hören sein. Ich komponiere tonal, ich werde auch einige Anleihen beim Jazz nehmen, aber es ist kein Crossover. Es ist alles sehr melodisch.
Sie sind ja bekannt als großer Improvisateur. Spielt das auch eine Rolle?
Nein, alles ist festgelegt. Obwohl: In der Partitur der Fußballoper gibt es auch einen Klavierpart, den ich auf jeden Fall bei der Premiere spielen will. Vielleicht improvisiere ich da ein bisschen. Aber im Moment bewege ich mich eher in der Welt der Klassik, und da muss ja alles aufgeschrieben werden. So ist mein Leben im Moment.
Ist das neu für Sie?
Ja und nein. Ich habe als Sechsjähriger im Chor Bach und Mozart gesungen, mich danach aber viel mit Musical, Pop und Jazz beschäftigt. Jetzt kehre ich quasi zu meinen Wurzeln zurück.
In Ihren Konzerten, auch in der „ Bremer Freitagnacht“, bei der Sie mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen auftreten, spielt Improvisation eine große Rolle. Gibt es da Grenzen für Sie?
Was ich gar nicht mag sind Improvisationen, die sich komplett von der Vorlage lösen, wie beispielsweise im Free Jazz. So etwas kreiert Musik für einen inneren Zirkel, aber es teilt sich dem Publikum nicht mit, und ich möchte immer eine Verbindung zum Publikum herstellen. Ich mag die Improvisation nach Regeln, ich möchte immer noch die melodische Grundlage heraushören können bei all den solistischen Schichten, die es zusätzlich geben kann. Das ist das, was ich mein ganzes Leben lang gemacht habe.
Sie machen das sogar bei Mozart.
Und auch da muss man Regeln befolgen. Man kann nicht einfach in einen ganz anderen Stil springen, mit einem Ragtime oder einem Blues kommen, eigentlich mit überhaupt nichts, was zeitgenössisch ist. Ich versuche, mich in das Mozart-Universum zu beamen, also etwas Angemessenes zu machen, die Motive und Themen zu respektieren. Und trotzdem denke ich jedes Mal: Vielleicht ist das jetzt doch zu gewagt? Das ist viel schwieriger, als frei zu improvisieren.
Sie wollen die Verbindung zum Ursprung nicht verlieren.
Das ist der Kern des Ganzen. Nachdem ich das jetzt alles gesagt habe, muss ich aber gestehen, dass es in Finnland einmal im Jahr eine dreistündige Radioshow mit mir gibt, bei der ich total frei improvisiere. Die Hörer können am 22. Dezember anrufen, mir eine Geschichte erzählen, und ich lasse mir live Musik dazu einfallen. Das ist sehr fordernd, obwohl ich schon so geübt bin, dass mir schnell Tonarten zu den Geschichten einfallen. Für Langweiliges wähle ich C-Dur, Beeindruckendes steht in F-Dur, Trauriges natürlich in b- oder d-Moll. Besonders beliebt sind übrigens Anekdoten über Haustiere: Hunde, die in eiskaltes Wasser gefallen sind, und so weiter.
Wenn man sich Live-Aufnahmen Ihrer Konzerte anhört, beispielsweise die aktuelle CD, die Sie mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen aufgenommen haben, scheint es so, als seien Sie immer auf der Suche nach dem magischen Moment, der Sie mit dem Orchester und gleichzeitig mit den Zuhörern verbindet.
Ich wähle die Stücke für meine Programme sehr genau aus, um emotional möglichst nah an das Publikum heranzukommen. Sogar meine Ansagen zwischen den Titeln lege ich oft so an. Mich hat während meines Jazz-Studiums dieser Habitus von Miles Davis total abgeschreckt. Er war sehr überheblich, manchmal hat er sogar mit dem Rücken zum Publikum gespielt und natürlich gar nicht geredet. Das war so ultra-ultra-cool, und ich habe mich immer gefragt: Ist das wirklich notwendig? Ich bin ernsthaft, wenn ich meine Stücke spiele, aber zwischen zwei Stücken sollten doch immer kleine, spaßige Dinge passieren. Ich möchte dem Publikum außerdem etwas über die Kompositionen erzählen, ich möchte alle mitnehmen und allen vermitteln, was Jazz ist; nicht nur den Jazz-Fans.
Als Sie die Einladung bekamen, bei „Sommer in Lesmona“ zu spielen, waren Sie da gleich begeistert?
Ja, das war ich. Es ist immer gut, wenn Konzerte nicht in den üblichen Räumen stattfinden. Für mich sind Sommer-Open-Air-Konzerte die Highlights im Jahr. Ich habe kürzlich in St. Moritz gespielt, da waren wir mitten im Wald, ohne Strom und sogar ohne Sitzplätze. Aber es war großartig.
Am Freitag werden Sie mit Menschen konfrontiert, die essen und trinken während des Konzerts.
Oh ja, das ist toll, ich finde so etwas gut. In Finnland wäre das Trinken ein Problem, da müsste man vorher spezielle Regeln aufstellen. Aber das läuft hier natürlich ganz zivilisiert ab.
Das Gespräch führte Iris Hetscher.
Iiro Rantala
wurde 1970 in Helsinki geboren und studierte Jazzpiano an der Sibelius-Akademie und klassisches Piano an der Manhattan School of Music. Er fühlt sich sowohl im Jazz wie auch in der Klassik heimisch, spielt in Jazz-Formationen, tritt auch mal mit einem Beatboxer auf und komponiert sinfonische Werke wie die "Tapiola Sinfonietta". Er ist mit der Schauspielerin Lotta Kuusisto verheiratet, der Schwester des finnischen Violinisten Pekka Kuusisto.
Weitere Informationen
Iiro Rantala und die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen: Mozart, Bernstein, Lennon. Label: ACT
Die CD ist die Live-Aufnahme des 2017er-Galakonzerts der Jazzahead in der Glocke. Finnland war im vergangenen Jahr das Partnerland der Jazzahead. Wer möchte, kann sich eine CD bei dem Konzert am Freitag signieren lassen.