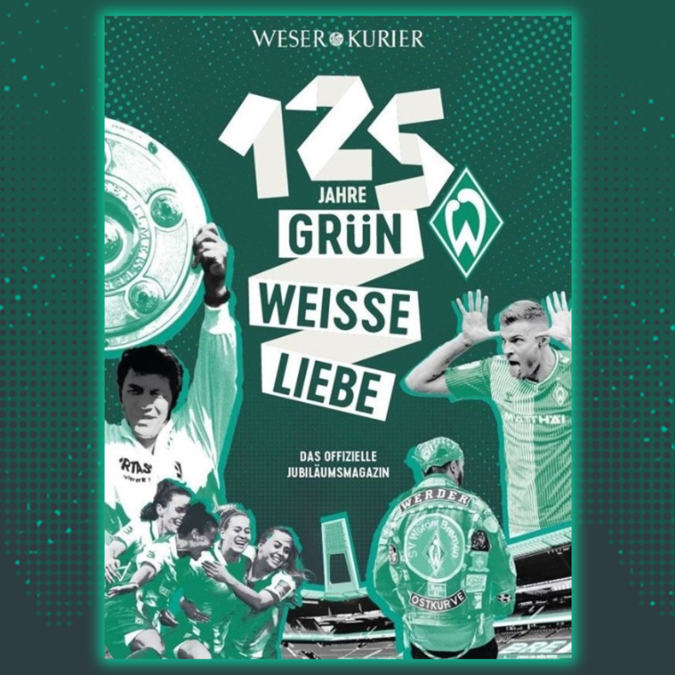Erst vor wenigen Tagen ist die diesjährige Saison des Weyher Freibades beendet worden. Nun stehen im Winterhalbjahr nur die beiden kleinen Schwimmhallen auf dem Freibadgelände und bei der Schule in Melchiorshausen für die Bevölkerung zur Verfügung. Passend zu diesem Zeitpunkt ist auch das Ende dieser kleinen Serie über die früheren Badeanstalten gekommen.
Dabei beschäftigten sich die historischen Seiten nur mit echten Badeanstalten und üblichen Badestellen, am Kirchweyher See, der Ochtum, im Lahauser Moor und Böttchers Moor. Mündliche Überlieferungen, Fotos und andere schriftliche Quellen bestätigen aber auch, dass alle natürlichen Gewässer an geeigneten Plätzen zum Baden genutzt wurden. So zum Beispiel die Weser selbst und alte Weserarme bei Dreye und Ahausen, der Wittrocksee im Kirchweyher Dorf, das Otten-Moor in Melchiorshausen und schließlich wurde auch im Hom- und Mühlbach an einigen Vertiefungen im Bereich von Leeste und Hörden gebadet.
Die Bedeutung der Hache
Eine besondere Bedeutung in dieser Region hatte aber die Hache, die von Syke kommend, die Weyher Ortsteile Jeebel, Lahausen, Kirch- und Sudweyhe durchquert, bevor sie beim Kirchweyher See ihren Namen aufgibt und zur Ochtum wird. Sie hatte nicht nur zahlreiche Badestellen, sondern spielte auch für Faltbootwanderer, Angler und die Landwirtschaft eine große Rolle.
Wie auch in anderen Bereichen bei Neubruchhausen, Jardinghausen, Henstedt, Syke und Barrien existierten in der Hacheniederung sogenannte Rieselwiesen. Das waren Wiesen und Viehweiden beiderseits des Baches, die im Winter bewusst überschwemmt wurden, um Schädlinge zu vertreiben und das Grünland durch die Ablagerungen zu düngen. Dazu schufen die Bewohner und Verbände kleine Stauanlagen und Gräben, über die sich das Wasser kontrolliert ausbreiten konnte. Im Lahauser, Sudweyher und Kirchweyher Raum existierten sie auch. Und gerade diese Sperrwerke, manchmal auch als Schleusen bezeichnet, sorgten für Vertiefungen und kleine Brücken. Das nutzten die Anwohner gerne und manche lernten hier sogar das Schwimmen. In Lahausen haben einige Fotos diese Badefreuden dokumentiert.
Sechs Wassermühlen
Die Hache mit nur 32 Kilometern Länge hatte früher sogar sechs Wassermühlen: zwei in Bensen, außerdem in Neubruchhausen, Syke, Barrien und Sudweyhe. Die Mühlenteiche waren oft die einzige Möglichkeit im Ort, um zu baden und Abkühlung im Wasser zu erhalten. Nicht zu vergessen, dass eine Badewanne oder eine Dusche in den Häusern früher noch nicht vorhanden waren.
Der Kirchweyher Lehrer Heinz Voigt fotografierte am 27. August 1959 badende Kinder in der Hache unweit der Kirche. Er schuf mit dem Foto ein Zeitdokument und die historische Erinnerung an die allerletzte Möglichkeit, in dem kleinen Bach zu baden. Auf dem Foto ist auch noch mehr festgehalten worden: Im Hintergrund stehen ein Kran, der die Rinne für den neuen Hachelauf ausbaggert, ein Lastwagen und ein alter Baum, der später ebenfalls beseitigt wurde.
Umweltbewusstsein hat sich gewandelt
Es war die Zeit, in der viele der bis dahin natürlichen Bäche begradigt und tiefergelegt wurden. Alte Bäume spielt dabei keine Rolle, sie wurden rigoros gefällt. Die schnelle Entwässerung der Wiesen war das Ziel, danach konnte bis an die Uferzonen Ackerland geschaffen werden. Inzwischen hat sich das Umweltbewusstsein komplett gewandelt. Um das Wasser in der Region zu halten, werden künstliche Regenrückhaltebecken, Überschwemmungsflächen und Flutmulden angelegt. 2017 erfolgte sogar ein kleiner Rückbau der Hache unweit des Freibades.
Heinz Voigt hatte in den Jahren zuvor auch noch andere Bilder fotografiert: Sein Sohn und dessen Freunde nutzten in den 1950er-Jahren mit ihren Faltbooten die alten Stromschnellen der Hache für eine Art "Wildwasserfahrt". Wobei die zahlreichen niedrigen Brücken die größte Herausforderung waren – auch alles Geschichte.