„Wie hast du denn sprechen gelernt?“, ist eine Frage, die Gaby Lièvre als Kind oft gestellt wurde. Und die sie widersinnig fand. Bei ihr zu Hause war schließlich alles normal. Ihre Eltern konnten sprechen und sich mit ihr verständigen. Seiner Umwelt gab das gehörlose Elternpaar mit dem hörenden Mädchen aber nicht selten Rätsel auf. Lièvre ist „Coda". Die Abkürzung stammt aus dem Englischen, steht für Children of Deaf Adults und meint Kinder von gehörlosen Erwachsenen. Dabei sind entweder beide oder nur ein Elternteil gehörlos, spätertaubt oder schwerhörig. Nach Angaben des Deutschen Gehörlosen-Bunds leben in Deutschland rund 80.000 Gehörlose, was circa 0,1 Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht. Etwa 90 Prozent der gehörlosen Elternpaare bekommen hörende Kinder.
Maßgeblich prägend für Coda-Kinder ist das Aufwachsen in zwei verschiedenen Kulturen und mit zwei unterschiedlichen Sprachen. Innerhalb der Familie wird meist die Deutsche Gebärdensprache – kurz DGS – verwendet. Obwohl ihre Geschichte einige Jahrhunderte zurückreicht, wurde die DGS erst im April 2002 als eigenständige Sprache anerkannt. Sie hat ein umfangreiches Vokabular, eine eigene Grammatik und wird durch Handbewegungen, aber auch von Mimik, Mundbewegungen und Körperhaltungen bestimmt. Innerhalb der Gehörlosengemeinschaft existieren zudem eigene Sitten und soziale Aspekte, die sich von der hörenden Welt unterscheiden. Durch den direkten Kontakt zu Verwandten, Nachbarn, Freunden, in der Kindertagesstätte und in der Schule haben Codas gleichzeitig Zugang zur Lautsprache. Elektronische und soziale Medien tun ihr Übriges.

Die Bildkombo zeigt die Gebärdendolmetscherin Kathrin-Maren Enders, die ihre Finger sprechen lässt. Die Einführung der Gebärdensprache als Wahlfach an hessischen Schulen wäre für Enders ein wichtiges Signal an gehörlose Menschen.
Das bilinguale Aufwachsen bringt Vorteile, aber auch Nachteile mit sich. Einige hörende Kinder fühlen sich zwischen beiden Welten hin- und hergerissen. So ging es auch Gaby Lièvre. „Es fühlte sich manchmal so an, als ob eine Seite an mir zieht und die andere auch“, sagt die 60-Jährige. „Inzwischen habe ich jedoch meinen Frieden damit gemacht, in der Welt der Hörenden zu leben, und dass ich die Welt der Gehörlosen ebenso kennenlernen durfte.“
Dabei geholfen hat ihr das Buch „Worte in die Stille“, in dem sie ihr Leben als Kind gehörloser Eltern aufgearbeitet hat. Drei Jahre hat sie daran gearbeitet. Mit ihrer Biografie möchte sie Mut machen. „Ich wünsche mir, dass andere Kinder gehörloser Eltern durch meine Geschichte erkennen, dass ein fehlendes Sinnesorgan keinen Abbruch an der Liebe von Eltern zu ihrem Kind tut. Ich wünsche mir für andere Betroffene, dass sie mit ihren Eltern mehr das Gespräch suchen. Dass sie dranbleiben, auch wenn es schwierig wird“, schreibt die Autorin.
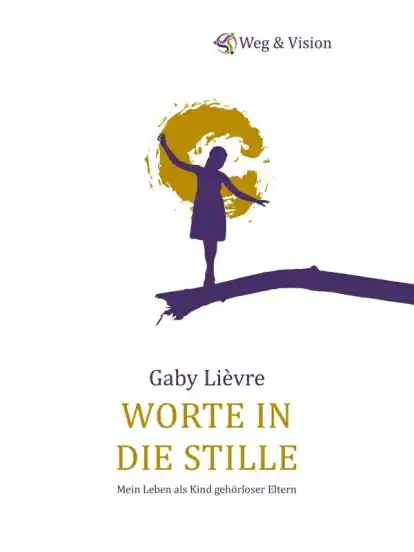
Über ihr Leben mit gehörlosen Eltern hat Gaby Lièvre ein Buch geschrieben. Es heißt "Worte der Stille" und ist im Weg-und-Vision-Verlag erschienen.
Lièvres Eltern lernten sich in der Gehörlosenschule kennen und heirateten im Dezember 1955. Der Vater hatte durch eine Hirnhautentzündung als Einjähriger sein Gehör verloren. Die Mutter war von Geburt an gehörlos, allerdings nicht gänzlich, wie sich später herausstellte. In den 1970er-Jahren erhielt sie zwei Hörgeräte, mit denen sie sogar einfache Telefonate führen konnte. Zumindest mit Menschen, die sie kannte. In der Schule, die beide besuchten, wurde die lautsprachliche Lehrmethode angewandt – was damals nicht unüblich war. Insbesondere, um kein Aufsehen zu erregen. Denn Berta und Josef Lièvre wuchsen in einer Zeit auf, in der es gefährlich war, „anders“ zu sein. Gehörlose galten zwischen 1933 und 1945 als „lebensunwert“ und wurden von den Nationalsozialisten verfolgt, teilweise zwangssterilisiert oder ermordet; die Verwendung der Gebärdensprache war verboten. Wann und wie Lièvres Eltern sie dennoch erlernt haben, ist unklar.
„Untereinander haben sie gebärdet, mit mir allerdings in Lautsprache kommuniziert“, sagt sie. Innerhalb der Familie, mit Freunden sowie in kleineren Runden, wo die beiden von den Lippen ablesen konnten, funktionierte die Verständigung ebenfalls. Im Kontakt mit Fremden oder bei komplizierteren Sachverhalten – etwa bei Arztbesuchen oder Behördengängen – musste die Tochter übersetzen. Zwangsläufig stand sie dadurch im Vordergrund und fühlte sich damit nicht immer wohl. „Ich wollte einfach, dass meine Mutter das konnte! Verstehen und verstanden werden. Ich wollte, dass sie gut dastand vor diesen Herren im weißen Kittel“, resümiert sie in ihrem Buch.
„Für viele Gehörlose ist der Dolmetscherbedarf in einer Umwelt, die sich mit der Thematik nicht auskennt, eine Belastung“, schreibt die Diplom-Sozialpädagogin Katharina Gerlach in ihrer Diplomarbeit „Hörende Kinder gehörloser Eltern: Herausforderungen für die Sozialpädagogische Familienhilfe unter Berücksichtigung der speziellen Kommunikationssituation“. Oft werde der Dolmetscher als Gesprächspartner angesehen, wodurch die Kommunikation über den Betroffenen hinweg liefe und seine Meinung nicht zähle, so Gerlach weiter.
Solche Situationen kennt auch Thekla Werk. „Hörende suchen in der Begegnung immer den bequemsten Weg. Wenn jemand Hörendes in der Runde ist, fragen sie immer die Person und nicht mich“, sagt sie. „Es wäre schön, wenn sie den Mut hätten, direkt in den Kontakt zu treten.“ Ihr selbst fällt es im Gegenzug leicht, auch ohne Dolmetscher auf Menschen zuzugehen.
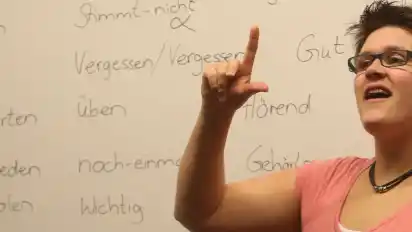
Thekla Werk zeigt in einem Kurs die Grundlagen der Gebärdensprache.
Die 38-Jährige ist von Geburt an gehörlos und arbeitet als Gebärdensprachlehrerin. Sie wuchs als einziges nicht hörendes Kind in einer hörenden Familie auf. In ihrer Familie wurde keine Gebärdensprache verwendet, Werk musste sich immer anpassen und fühlt sich seit jeher in der Welt der Gehörlosen wohler. Den Begriff gehörlos mag sie im Übrigen nicht. Ebenso wie das veraltete Wort taubstumm. „Ich empfinde beides als Stigmatisierung. Gehörlos setzt voraus, dass etwas fehlt. Und stumm bin ich auch nicht. Ich habe meine Sprache, die Gebärdensprache“, erläutert Werk. Sie bevorzugt die Bezeichnung taub – und es ist ihr wichtig, dass hörende und taube Kinder gleichbehandelt werden. „Jedes hat seine eigenen Talente“, sagt sie.
Ihre beiden Kinder Leif und Cla sind schwerhörig. Sie besuchen die Gehörlosenschule und sprechen Gebärdensprache. Der neunjährige Leif beherrscht auch die Lautsprache, unter Hörenden wirkt er jedoch sehr zurückgezogen. „In der Welt der Gehörlosen ist er ein vollkommen anderes Kind“, sagt seine Mutter. „Er ist viel freier, muss sich nicht wegen seiner Hörgeräte erklären oder überlegen, wie er wahrgenommen wird. Er kann einfach er selbst sein.“
Thekla Werk arbeitet beim Landesverband der Gehörlosen Bremen und ist dort für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Der Verband bietet vielfältige Veranstaltungen, fungiert als Beratungsstelle und ist die Vermittlungszentrale für Gebärdensprachdolmetscher. Denn für offizielle Termine, wie Arztbesuche oder Behördengänge, ist der Anspruch auf einen Dolmetscher inzwischen rechtlich verankert. Dennoch gibt es im täglichen Leben noch etliche Barrieren. Werk möchte das ändern und macht sich für das Thema Inklusion stark. „Aktuell erarbeiten wir zusammen mit der Kunsthalle Bremen Videoguides für Gehörlose“, berichtet sie. Für Schulen oder Ämter zum Beispiel wünscht sie sich, dass Lehrkräfte und Mitarbeitende neben der Laut- auch die Gebärdensprache beherrschen.




