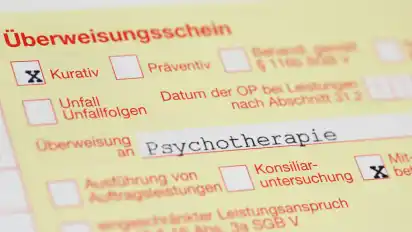Triggerwarnung: In dieser Serie werden sensible Inhalte rund um psychische Erkrankungen bis hin zu Suizid thematisiert.
Die Corona-Pandemie bringt auch eine psychologische Krise mit sich. Laut Psychotherapeutenkammer Bremen zeigt sich eine Zunahme an psychischer Belastung in der Bevölkerung und eine deutlich erhöhte Nachfrage nach psychotherapeutischer Behandlung. Nach Angaben der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung (DPTV) ist der Bedarf an einem Therapieplatz um 40 Prozent gegenüber 2020 gestiegen. Die Folge ist, dass Betroffene oft noch länger auf einen Therapieplatz warten müssen.
"Wir haben in Bremen eine relative hohe Nachfrage trotz der vermeintlich hohen Anzahl an Praxen", sagt Psychotherapeut Christoph Sülz im Interview mit dem WESER-KURIER. In Bremen gibt es 458 psychologische und ärztliche Psychotherapeuten. Der überwiegende Teil davon befindet sich in der Innenstadt, besonders in Schwachhausen und der Östlichen Vorstadt, wie ein Blick auf die Karte zeigt.
In Bremen gibt es eine gedeckelte Anzahl an Therapieplätzen, deren Kosten von Krankenkassen übernommen werden können. Diese Anzahl an krankenkassenärztlichen Therapieplätzen wird durch eine Bedarfsplanung geregelt. Diese wurde 2019 bundesweit noch einmal angepasst. Demnach reicht eine Psychotherapeutenstelle auf 3190 Bremern, um den Bedarf abzudecken.
Um dieses gesetzliche Soll zu erfüllen, bräuchte es 178,5 solcher Stellen in Bremen – im Bedarfsplan sind sogar 311,4 Stellen angegeben (Stand Ende 2019). Laut Sülz reicht dies trotzdem nicht aus, um die gestiegene Nachfrage zu decken. Betroffene können zwar auf eine private Praxis ausweichen und sich das Geld von der Krankenkasse zurückholen. Doch auch dort sind die Anfragen stark gestiegen.
Pressesprecher Lukas Fuhrmann des Bremer Gesundheitsressorts verteidigt die damals angepasste Planung: "Diese Maßnahmen sind natürlich alle beschlossen worden, ohne die Herausforderungen der Corona-Pandemie vorherzusehen." Ob es im Zuge der Krise mehr Plätze geben muss, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verlässlich bewertet werden. "Die Gesundheitsbehörde ist mit den Akteuren in der Versorgung von Menschen mit psychischer Erkrankung kontinuierlich im Gespräch über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die verschiedenen Feldern der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung", sagt Fuhrmann.
Mehr Menschen suchen einen Therapieplatz
In vielen Praxen schnellen die Anfragen von Betroffenen jedenfalls in die Höhe. Das geht aus einer Umfrage der DPTV unter fast 5000 psychotherapeutischen Praxen in Deutschland hervor. Im Januar vergangenen Jahres haben demnach gut 70 Prozent der Praxen maximal fünf Therapieanfragen die Woche bekommen. Im Januar dieses Jahres waren es nur noch gut 50 Prozent der Praxen, viele verzeichneten deutlich mehr Anfragen pro Woche.
Auch bei den Psychotherapeuten für Kinder- und Jugendliche ist laut DPTV die Zahl der Anfragen im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie um 60 Prozent gestiegen. "Je länger die Pandemie läuft, desto mehr sind einzelne Kinder psychisch sehr betroffen und werden das möglicherweise auch ihr Leben lang mitnehmen", sagt Marc Dupont, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Klinikums Bremen-Ost im Gespräch mit dem WESER-KURIER.
Mehr Patienten führen zu mehr Wartezeiten
Schon vor der Pandemie waren die Wartezeiten auf einen Behandlungsplatz sehr lang – nun werden sie noch länger. Laut Umfrage der DPTV müssen fast die Hälfte aller Patienten länger als einen Monat auf ein Erstgespräch warten, obwohl sie Anspruch darauf haben, innerhalb von vier Wochen einen Termin zu bekommen.
Seit 2019 ist dieses Erstgespräch verpflichtend, bevor Betroffene einen Therapieplatz bekommen können. Dabei soll mit einem Psychotherapeuten geklärt werden, "ob ein Verdacht auf eine psychische Krankheit vorliegt und der Patient eine Richtlinienpsychotherapie benötigt oder ob ihm mit anderen Unterstützungs- und Beratungsangeboten geholfen werden kann", wie es bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen heißt. Neben den Erstgesprächen gibt es auch andere Anlaufstellen für einen Erstkontakt mit dem Thema.
Ein Erstgespräch garantiert noch nicht, dass auch direkt ein Behandlungsplatz gefunden werden kann. Auch hier gibt es lange Wartezeiten. Fast 40 Prozent der Patienten warten länger als sechs Monate. Anders als bei Hausärzten sind Therapiestunden auf genau 50 Minuten festgelegt. Psychotherapeuten können also nicht der Reihe nach Patienten aus dem Wartezimmer abarbeiten, sie können an einem Tag nur eine bestimmte Anzahl an Terminen vergeben. Hinzu kommt, dass es je nach Schwere der Krankheit unterschiedliche viele Folgetermine geben muss.
Krankenkassen haben dabei oft eigene Therapieklassen mit unterschiedlich vielen Sitzungen. Eine Langzeittherapie bei der Barmer Krankenkasse umfasst etwa bis zu 60 Therapieeinheiten à 50 Minuten. Ein Psychotherapeut kann in der gleichen Zeit also nicht die gleiche Menge an Patienten behandeln wie zum Beispiel ein Zahnarzt. Sich von diesen starren Therapieeinheiten zu lösen, ist für Sülz ein Lösungsansatz: "Es wäre in meiner Vorstellung wünschenswert, da zeitlich noch flexibler zu sein. Da brauchen wir noch mehr Innovationen."
Frauen stärker betroffen
Unter den psychisch Erkrankten sind deutlich mehr Frauen als Männer – und das über alle Altersgruppen hinweg. Männer nehmen sich hingegen deutlich häufiger das Leben als Frauen. Rund 76 Prozent der Selbsttötungen im Jahre 2019 wurden von Männern begangen.
Gerade Männern falle es immer noch schwer, zuzugeben, dass sie ein Problem haben, mit dem sie alleine nicht fertig werden, sagt Herbert Gärtner, der sich im Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe engagiert. Ähnliches berichtet Anne-Maria Möller-Leimkühler, die an der Ludwig-Maximilians-Universität in München zum Thema Männer und Depressionen forscht, dem Bayrischen Rundfunk. Sie ist der Meinung, dass das klassische Rollenbild des starken Mannes, der keine Schwäche zeigen darf, ein Erklärungsansatz für den "Gender-Gap" sein könnte.