Die Welt schaut auf den Klimagipfel in Glasgow – und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven sind dabei. Wie haben sie die Atmosphäre vor Ort und den Austausch erlebt? Vier Perspektiven auf die Konferenz, die die Welt verändern soll.

Antje Boetius Alfred-Wegener-Institut Polarforscherin
DE: Porttät von Antje Boetius in Lloyd Werft, Bremerhaven EN: Portrait of Antje Boetius in Lloyd Werft, Bremerhaven.
Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts und Meeresbiologin
Es mache ihr Sorgen zu sehen, wie die bisherigen Ergebnisse des Klimagipfels schlecht geredet würden, sagt Antje Boetius, Meeresbiologin und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts. Aktivistin Greta Thunberg hatte die Konferenz als "Greenwashing-Festival des globalen Nordens" bezeichnet und sie eine "Feier des Business as usual und des Blablabla" genannt.
"Teile der Jugend äußern laut ihre Enttäuschung, da die Risiken für ihre Zukunft gefühlt steigen", sagt Boetius. Es sei verständlich, wenn die jungen Leute sagten: Warum stoppen wir die Abholzung nicht heute?, findet sie. Sie sei aber aus langjähriger Erfahrung heraus froh, dass es in den Verhandlungen nun gelungen sei, sich auf das Jahr 2030 zu verständigen. Es sei ermutigend zu wissen, dass es eine Plattform gebe, wo mit allen Ländern verhandelt werde. "Ich habe Hoffnung, dass es große Schritte in die richtige Richtung gibt. Es geht nur mit politischen Verhandlungen." Und dafür seien Mut, Zuversicht und Zusammenhalt entscheidend. Blockaden und Kritik würden nicht weiterhelfen.
In Glasgow lerne sie nicht nur Menschen aus der ganzen Welt kennen, wenn sie etwa mit einem der vielen Shuttlebusse durch die Stadt fahre, erzählt Boetius, sondern auch die Länder und Landschaften, in denen sie leben. Einen Nachmittag lang habe sie sich Zeit genommen, die Stände und Pavillons vor allem der afrikanischen Staaten zu besuchen, Fotos anzuschauen, ins Gespräch mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu kommen. Dabei gehe es natürlich darum zu fragen, was für den Schutz von Landschaft und Natur getan werden muss – aber auch darum, welche Rolle sie beim Klimaschutz einnehmen können: "Wie kann man mit der Natur zusammenarbeiten? Was brauchen Meere und Moore, damit sie CO2 zurückholen können?" Das sei auch für die Arbeit am Alfred-Wegener-Institut wichtig.
Sie sehe positive Schritte in den ersten Ergebnissen der Verhandlungen, sagt Boetius. Zugleich hoffe sie, dass auch das Regelwerk zur Überprüfung der nationalen Länderziele so ausgestaltet wird, dass es greift. "Alles, was wir heute nicht schaffen, macht die Zukunft noch unsicherer", sagt Boetius.

Marcel Nicolaus Alfred-Wegener-Institut
Marcel Nicolaus, Meereisphysiker
"Was treibt die Gemeinschaft der afrikanischen Kirchen an, herzukommen?" Er habe sich das schon etwas verwundert gefragt, berichtet Marcel Nicolaus, Meereisphysiker und für drei Tage Teilnehmer des Klimagipfels in Glasgow. Er habe viele unterschiedliche Menschen dort gesehen, in Trachten, teilweise uniformartig, Vertreter indigener Völker. Sie alle seien dort, weil die Erderwärmung ihr alltägliches Leben verändere, sagt Nicolaus. "Diese Vielfalt, die der Klimawandel betrifft, davon machen wir uns nur selten ein Bild. Welche sozialen Komponenten es hat, wenn sich Lebensräume verändern."
So wie in der Arktis, die Nicolaus' Forschungsraum ist. Vier Millionen Menschen leben dort, die Grenze liege näher an Bremerhaven als die Mittelmeerküste. Für mehrere Monate war sie für den Wissenschaftler eine Art Heimat: Er war Teil der Mosaic-Expedition, die erstmals die Auswirkungen des Klimawandels in der Polregion erforschte. "Wir sehen jedes Jahr deutlicher, wie das Eis zurückgeht. Man kann es nach wie vor noch retten", sagt Nicolaus. Aber 2050 werde es sehr wahrscheinlich so sein, dass es ein paar eisfreie Tage in der Arktis gebe. Irgendwann könnten es Monate sein.
"Was mir die größten Sorgen macht, ist die Trägheit", sagt er. Schon seit 20 Jahren sei das Problem bekannt. Am wichtigsten sei deshalb die öffentliche Aufmerksamkeit: "Dass es diese Klimakonferenz in dieser Größe und diesem Umfang gibt, das gibt den Rahmen dafür, das Ganze auf die große Bühne zu heben." Die Stimmung auf dem Gipfel habe er als positiv und konstruktiv erlebt, sowohl bei seinem Vortrag als auch drumherum, sagt Nicolaus. Politiker, Wissenschaftler und Journalisten hörten zu, stellten Fragen zur Arktis-Expedition. "Der Wille war an ganz vielen Ecken zu sehen: Wir müssen was ändern." Er sei zuversichtlich, dass das auch klappen könne, klappen werde. ",Wir schaffen das sowieso nicht' hilft uns nicht. Denn was dann?"
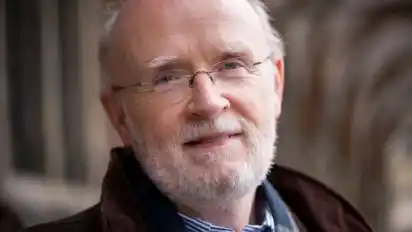
Hans-Otto Pörtner Alfred-Wegener-Institut
Hans-Otto Pörtner, Meeresbiologe und IPCC-Arbeitsgruppenvorstand
Für Hans-Otto Pörtner geht es beim Klimagipfel vor allem darum, Leute zu treffen, zu netzwerken, und zwar schon seit vielen Jahren. Denn Pörtner ist nicht irgendwer, sondern einer, dem viele Menschen dort sehr aufmerksam zuhören: Er ist einer der beiden Ko-Vorsitzenden der Arbeitsgruppe 2 des IPCC-Berichts, also dem Dokument, in dem der aktuellste Stand der Wissenschaft zum Thema Klimawandel niedergeschrieben wird. Noch ist der Bericht seiner Arbeitsgruppe nicht fertig, deshalb muss Pörtner auf diesem Gipfel keine Ergebnisse präsentieren. Aber er sitzt sozusagen auf heißen Kohlen: Im Februar soll es soweit sein.
"Wir können uns nicht nur auf den Klimawandel konzentrieren, sondern wir müssen uns auch auf die Biodiversität und die gesellschaftliche Krise, die soziale Seite, konzentrieren" – das ist die wichtigste Botschaft, die der Meeresbiologe überbringen will. Die Frage nach Gerechtigkeit, nach Unterstützung für die Länder, die am stärksten betroffen sind, schwinge bereits mit bei den aktuellen Verhandlungen, sagt Pörtner, viel deutlicher als in der Vergangenheit. Und zugleich erlebe er in Glasgow eine laute, starke Öffentlichkeit, "die demonstriert hat, dass sie auf Ergebnisse wartet, auf Ergebnisse pocht".
Das Zusammenkommen von Gesellschaft, Politik und Wissenschaft ist für Pörtner entscheidend, und dabei hat jeder seine Rolle. Während die Öffentlichkeit, vor allem die jungen Leute, Druck machten, sei es Aufgabe der Wissenschaft, Lösungsoptionen zu diskutieren und Ansätze für eine nachhaltigere Zukunft anzubieten. Die Politik schließlich muss verhandeln, und dabei auch mit den Ländern im Gespräch bleiben, die auf die Bremse treten. Bislang seien deren Ergebnisse für ihn eine Mischung aus positiven Signalen – etwa bei den Themen Kohleausstieg und Ende der Abholzung – und Frustration, sagt Pörtner. Für ihn ist eindeutig: "Wenn Politik den Willen nicht alleine entfalten kann, dann muss die Gesellschaft klarmachen: Es ist uns wichtig, dass wir einen gesunden Planeten haben."

Jens Strauss Permafrost Alfred-Wegener-Institut
Jens Strauss, Permafrost-Forscher
Check-ins hat Jens Strauss jetzt erst einmal genug erlebt. Der Permafrost-Forscher am Alfred-Wegener-Institut ist mit dem Flugzeug zum Klimagipfel nach Glasgow geflogen, hatte also schon einige Sicherheitskontrollen hinter sich, als er zum Konferenzgelände kam. Dort ging es dann weiter, drei, vier Checks musste Strauss absolvieren, bis er dort war, wo er hinwollte: im Pavillon, der aussieht wie eine Eisscholle. Dabei waren seine Gedanken eigentlich woanders.
Der Klimagipfel in Glasgow sei weniger mit einer wissenschaftlichen Konferenz zu vergleichen als mit einer "Mini-Expo". Schräg gegenüber sei der britische Pavillon gewesen, die EU habe auch einen gehabt, erzählt Strauss. Gerade einmal 20 Leute durften coronabedingt bei den drei Vorträgen des Permafrost-Thementags im Eisschollen-Pavillon vor Ort sein, deshalb sprachen Strauss und seine Kollegen auch in die Kamera, für den Livestream. Insgesamt sei der Gipfel eine beeindruckende Erfahrung gewesen, findet er.
Aber Sorgen macht Strauss sich vor allem um das, was derweil in Russland und Alaska geschieht, seinen Hauptarbeitsgebieten: Permafrostböden, also tief gefrorene Bodenschichten, fest wie Zement, erwärmen sich. Die Menge an Klimagasen wie Methan und Kohlenstoff, die darin bislang eingeschlossen sind, sei riesig, sagt Strauss: "Und dieses System erfährt gerade sehr viel Veränderung."
Seien die Böden einmal aufgetaut, gebe es kein Zurück. Deshalb beunruhigt es ihn, dass derzeit auch an Szenarien gedacht werde, in denen eine Zeit lang zwar zu viele Treibhausgase für das 1,5-Grad-Ziel ausgestoßen würden ("Overshoot"), diese dann aber in Zukunft mit Hilfe von Technologien wieder eingefangen werden sollen. "Mit Overshoot will man sich eigentlich nur Zeit erkaufen, um zu handeln", sagt Strauss. Und die werde knapp, weil die bereits angestoßenen Prozesse auch ohne weitere Erwärmung noch 100 bis 200 Jahre so weiterlaufen. "Ich denke nicht, dass wir auf dem richtigen Weg sind", findet er, und genau deshalb sei der Gipfel so wichtig: "Wenn man die Leute nicht an einen Tisch kriegt, passiert gar nichts." Außerdem schaffe die Mega-Veranstaltung eine große öffentliche Bühne – nicht zuletzt für die Proteste der zehntausenden jungen Menschen.




