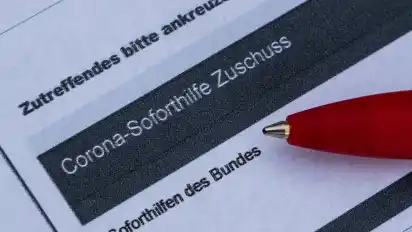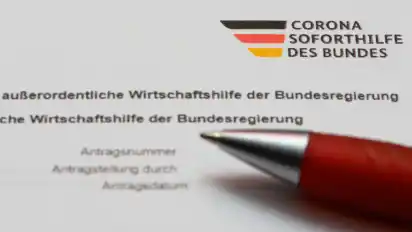Bremen/Hannover. Viele Unternehmen zahlen die Corona-Soforthilfen derzeit freiwillig an Bund und Länder zurück. Das bestätigt das Bremer Wirtschaftsressort. Die Behörde meldet, dass sie bislang freiwillige Rückzahlungen von mehr als 1,96 Millionen Euro erhalten hat. Das Ressort geht davon aus, dass zumindest ein Teil der Firmen auf diesem Weg Prüfungen vermeiden will. Zusätzlich hat die Verwaltung 114.000 Euro zurückgefordert.
Die Länder haben dem Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt, dass sie bei den Unternehmen „Rückzahlungen in Höhe von 322 Millionen Euro geltend gemacht haben und dass darüber hinaus freiwillige Rückzahlungen in Höhe von 911 Millionen Euro“ geleistet worden seien. Das teilt eine Ministeriumssprecherin mit.
In Niedersachsen haben Unternehmen freiwillig rund 70 Millionen Euro an Pandemie-Unterstützung zurückgezahlt. Laut Wirtschaftsministerium in Hannover betraf dies 62 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen sowie acht Millionen Euro Überbrückungshilfen aus dem vergangenen November und Dezember. Konkrete Gründe für diese Erstattungen seien nicht genannt worden. „In der Regel hat sich die wirtschaftliche Entwicklung des betroffenen Unternehmens deutlich besser entwickelt als es zu Beginn der Krise oder der jeweiligen Förderung den Anschein hatte“, erklärt das Ministerium.
Summen über von Bund oder Land zurückgeforderte Hilfen bezifferten das Wirtschaftsressort und die landeseigene Förderinstitut N-Bank nicht. Derzeit führten Bund und Länder Gespräche über Rückzahlungsmodalitäten. Dabei gehe es unter anderem um Bagatellgrenzen und Stundungen für Rückzahlungen. „Die Gespräche laufen noch, Ergebnisse sind in den nächsten Wochen zu erwarten.“ Alle Corona-Hilfen zusammengenommen, wurden über die N-Bank mehr als fünf Milliarden Euro in Niedersachsen ausbezahlt.
„Um die Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft abzumildern, war beherztes und schnelles Handeln nötig“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) gegenüber dem WESER-KURIER. Die Corona-Hilfsprogramme in Deutschland seien ein großer Erfolg. Man habe die Krise wirtschaftlich besser weggesteckt als viele andere Staaten in Europa. „Bund und Länder haben das dank eines finanziellen Kraftakts möglich gemacht – insofern halte ich es nur für fair, wenn Unternehmen, die möglicherweise mehr Geld erhalten haben als tatsächlich benötigt, diese Beträge zurückzahlen“, betonte der Ressortchef.
Die Soforthilfen seien unter der Auflage bewilligt worden, dass zu viel gezahlte Unterstützung zurückgezahlt werden müsse, erläutert die Bremer Wirtschaftsbehörde. Einige Unternehmen würden diese Vorgabe beachten und vorsorglich zurücküberweisen, „um Prüfungen und Rückforderungen der Bewilligungsstellen zu vermeiden beziehungsweise zuvorzukommen“.
Das deckt sich mit den Erfahrungen des Bundes. Die Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagt: „Insbesondere hatten Unternehmen zum Zeitpunkt der Antragstellung teilweise höhere Liquiditätsengpässe für den dreimonatigen Förderzeitraum prognostiziert, als letztlich eingetreten sind, sodass jetzt entsprechende Überprüfungen und Rückzahlungen anstehen.“ Die Krise ist für die Betriebe demnach nicht so dramatisch ausgefallen, wie sie zunächst befürchtet hatten.
Die Länder müssen bis spätestens Mitte kommenden Jahres Schlussberichte vorliegen, aus denen hervorgeht, wie die Soforthilfen verwendet und ob die Bestimmungen eingehalten worden sind. Stichtag ist der 30. Juni 2022. Die Frage der Rückzahlung von Corona-Soforthilfen liegt laut Bundesministerium ausschließlich in der Zuständigkeit der Länder. Die Soforthilfen waren die ersten Hilfszahlungen für kleine Unternehmen im Frühjahr 2020.
Eine Auflistung, welche Branchen bei den freiwilligen Rückzahlungen die Hauptrolle spielen, gibt es nach Auskunft von Christoph Sonnenberg, Sprecher der Bremer Wirtschaftsbehörde, nicht. Was es allerdings gibt, ist eine Einschätzung, wie häufig die Soforthilfen missbräuchlich beantragt wurden. Das Ressort nennt zum jetzigen Zeitpunkt 75 Strafanzeigen und 52 Ermittlungsverfahren. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Betrugsversuche unentdeckt geblieben seien, heißt es. Das Wirtschaftsressort geht davon aus, dass die Betrugsversuche „unter einem Prozent liegen“.