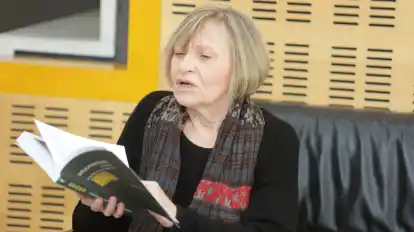Junge Erwachsene aus unterschiedlichen Nationen fahren auf Rennrädern „zurück nach Westerbork“. Was hat es damit auf sich, Frau Johr?
Barbara Johr: Die Idee war, dass junge Erwachsene aus den Niederlanden, Deutschland und Polen, durch die die Züge mit Deportierten gefahren sind, die Reise in umgekehrter Richtung machen: Die Radtour führt von Auschwitz nach Westerbork. Das ist ein symbolischer Akt. Die Tour ist seit Frühjahr 2020 zum dritten Mal in Planung – wegen der Pandemie.
Was ist über das Teilnehmerfeld zu sagen?
Die polnischen jungen Leute, die sich angemeldet hatten, konnten leider nicht rechtzeitig vollständig geimpft sein und die Tour nicht mitantreten. Es sind vor allem Studentinnen und Studenten mit unterschiedlichstem Hintergrund. Zwei Drittel sind Niederländer. Das geht von der Leistungssportlerin, die Rennrad fährt und mit der Tour Zugang zum politischen Hintergrund findet, bis zu einem Studenten, der sich extra ein Rad gekauft hat, um mitfahren zu können und großes Interesse hat an der Geschichte der Niederlande. Was allen eigen ist: Sie empfinden sich als junge Europäer.
Sind auch Bremerinnen und Bremer unter den jungen Leuten?
Nein, aber zum Beispiel eine Veganer-Wohngemeinschaft aus Bayreuth. Die haben gleich noch eine Rennrad fahrende Freundin mitgenommen. Das ist eine Begegnung mit diesen drei Ländern und mit Orten, die sehr speziell ist. Immer mit dem Blick darauf: Wozu erinnern? Weil wir eine gemeinsame Zukunft haben, mehr denn je.
Am Sonntag macht der Tross Station in Bremen. Welche Rolle spielt diese Etappe in der Mission, und was steht in Bremen auf dem Programm?
Die Tourstation Bremen hat den sehr besonderen Grund, dass Bremer Polizei, ein ganzes Bataillon, im Holocaust in den Niederlanden eingesetzt war. Unter anderem in Den Haag und dann im Sammel- und Durchgangslager Westerbork. Dort haben die Polizisten die Internierten bewacht, und vor allen Dingen haben sie die Züge von Westerbork nach Auschwitz begleitet und gesichert.
Darüber erfahren wir Sonntag mehr…
Darüber spricht der Senator für Inneres, Ulrich Mäurer, der vor zehn Jahren mit der Ausstellung über Bremens Polizei im Nationalsozialismus dafür gesorgt hat, dass die Geschichte der Polizeibataillone 105 und 303, das an den Massenerschießungen in Babi Jar beteiligt war, aufgearbeitet wurde.
Die öffentliche abendliche Zusammenkunft ist im St.-Petri-Dom geplant. Würden Sie das als einen interreligiösen Abend bezeichnen?
Das ist eine gute Frage. Die Veranstaltung im Dom findet mit Sicherheit in einer interreligiösen Situation statt, weil die jungen Erwachsenen, die dort im Mittelpunkt stehen, sehr unterschiedlichen Religionen oder auch gar keiner Religion angehören. Das haben wir in unseren Planungen gar nicht abgefragt. Ich denke, das ist ein Ort, der bleibende Erinnerungen an Bremen hinterlässt.
Und es geht um ein weiteres imposantes Gebäude…
Ich habe Führungen am Denkort Bunker Valentin vorgeschlagen. Die Stiftungsvorsitzenden waren hier und haben sich das angesehen – die waren erschüttert und haben gesagt: Wir wissen in den Niederlanden nichts davon. Obwohl ganz viele Niederländer zum Bau des Bunkers eingesetzt waren.
Eigentlich sollte die Radtour schon im vergangenen Jahr unter dem Motto „75 Jahre Frieden und Freiheit“ starten…
Ja, und jetzt heißt sie 75+1. Ursprünglich war ja mit 800 Teilnehmern geplant worden, dann mit 250, und jetzt ist sie am 22. August pandemiebedingt mit 80 samt Begleitern gestartet – wir machen keine Führung in der Stadt, gar nichts. Aber was geblieben ist, ist der Denkort Valentin. Westerbork, das ist wie Mechelen für Belgien oder Drancy für Frankreich das Sammel- und Durchgangslager zur Deportation in die Vernichtungslager gewesen. Auschwitz ist eine Ikone, aber diese Orte sind heute schon weit weniger bekannt. Das ist auch ein Grund, diese Tour zu machen, darauf hinzuweisen, wie unglaublich viele Orte des Geschehens der Holocaust oder die Shoah hat. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, das gilt eben nicht nur für Juden. Der Denkort spiegelt das mehr als deutlich.
Sie waren lange Zeit Projektverantwortliche für die Stolpersteinverlegungen in Bremen. Diese Radtour ist eine ganze andere Form des Gedenkens. Ist das ein Versuch, auch junge Leute anzusprechen, die sich weniger für Geschichte interessieren?
Die Veranstalter denken darüber nach, wie Erinnerungskultur in Zukunft aussehen kann, ohne dass sie mit einer moralisch-pädagogischen Keule kommt, dass sie nicht überwältigt, sondern dass sie dazu einlädt, sich mit diesem Teil der europäischen Geschichte zu befassen.
Und es gibt nicht mehr viele Zeitzeugen…
Das kommt hinzu. Es wird bald keine Überlebenden mehr geben, denen zu begegnen jungen Leuten möglich ist, um etwas zu erfahren über Holocaust, Shoah, NS-Zeit, Verfolgung und Vernichtung. Es werden in Zukunft die Orte sein, an die die Erinnerungsarbeit anknüpft, nicht mehr die Menschen. Der Bunker Valentin heißt ja schon Gedenkort.