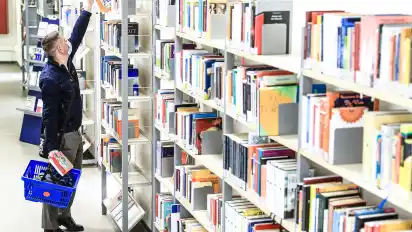Frau Werder, vom 24. bis zum 27. Juni findet der neunte Bibliothekskongress in Bremen statt – mit mehr als 3.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 20 Ländern. Das Motto des Fachkongresses lautet "#BibliothekenEntschlossenDemokratie". Ist das nicht selbstverständlich?
Lucia Werder: Wir sind als Stadtbibliothek gemeinsam mit der Staats- und Universitätsbibliothek insbesondere für alles zuständig, was in Bremen als Rahmenprogramm stattfindet, und wir waren auch eingebunden in die Formulierung des Mottos. Wir haben uns ganz bewusst für "#BibliothekenEntschlossenDemokratie" entschieden, auch wenn das eigentlich selbstverständlich ist. Aber es geht eben auch um eine Haltungsfrage.
Was heißt das?
Wir stellen in den Mittelpunkt, welche Haltung wir als Bibliotheksmitarbeiterinnen und -mitarbeiter zur Demokratie haben. Die meisten von uns sind im öffentlichen Dienst, und natürlich ist das Grundgesetz die Grundlage des Handelns. Aber wir fragen uns schon: Wie neutral sind wir? Wie weit positionieren wir uns als Einrichtungen, die für eine Stärkung der Demokratie stehen?
Was heißt das denn konkret: die Demokratie stärken? Das klingt gut, aber auch wolkig.
Es gibt viele Ansätze. Es geht darum, welche Räume wir anbieten, welche Hürden es gibt, um eine Bibliothek zu betreten und zu nutzen, wie willkommen die Menschen sich bei uns fühlen. Aber auch: Welche Veranstaltungen wir anbieten. Das können Formate sein, bei denen Menschen miteinander ins Gespräch kommen, oder Ausstellungen, die sich mit Themen befassen, die die Gesellschaft gerade umtreiben. Das geht bis zu den Kooperationspartnern, mit denen wir arbeiten, mit queeren oder migrantischen Communitys oder mit einem Verein wie Rat und Tat. Ein anderes Beispiel: Wir machen für Seniorinnen und Senioren einen Workshop, wie man mit dem Smartphone zurechtkommt. Wir kooperieren da mit Partnern wie beispielsweise mit der Brema, der Bremischen Landesmedienanstalt.
Was Sie beschreiben, geht weit über die ursprüngliche Aufgabe von Stadtbibliotheken hinaus, es erinnert an Volkshochschulen oder Beratungsstellen. Warum wandelt sich die Aufgabe von Bibliotheken so stark?
Es geht weiterhin bei uns um den Zugang zu Information, die informationelle Grundversorgung. Aber unsere Aufgabe ist es auch, lebenslanges Lernen zu unterstützen und die Förderung der Lesefähigkeit sowie der Medienkompetenz. Wir waren schon immer eine Anlaufstelle für alle, die ihre digitalen Kompetenzen aufbauen oder erweitern wollen. Dabei sind unsere Angebote offen und sehr gesprächsorientiert. Man muss keinen mehrteiligen Kurs belegen, das ist ein Unterschied beispielsweise zur Volkshochschule. Hinzu kommt die Funktion von Bibliothek als wichtiger Ort in der Stadtgesellschaft.
Als öffentlicher Raum, in dem man nicht konsumieren muss …
Ich kann mich dort einfach aufhalten, Freunde treffen, lernen. Ich bin dort nicht einsam – ein großes Thema derzeit in der Gesellschaft. Diese Verschiebung von einem Ort, der vor allem genutzt wird, um Bücher oder andere Medien auszuleihen, zu einem öffentlichen Ort findet mindestens seit zehn Jahren statt. Da ist die Stadtbibliothek auch schon gut aufgestellt, was die Aufenthaltsqualität angeht oder bei Dingen, die ich hier machen kann: lesen, aber beispielsweise auch Schach spielen oder Musizieren. Oder eben einfach da sein, ohne dass mich jemand fragt, was ich hier mache.
Welche weiteren Impulse erwarten Sie sich von dem Kongress?
Für uns ist das eine schöne Möglichkeit, zu präsentieren, was wir können, aber natürlich auch, uns auszutauschen mit Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt. Da wird es ganz besonders auch um Formate zum Thema Demokratieförderung gehen, beispielsweise um die Frage, wie man die Kundinnen und Kunden stärker einbeziehen kann bei der Gestaltung von Angeboten. Aber auch um den Einsatz von KI im Bibliotheksalltag oder darum, wie man Mitarbeiter gewinnt.
In anderen Ländern nimmt man Bibliotheken als öffentliche Räume für die Stadtgesellschaft richtig ernst. Das heißt, sie sind bis weit in die Abendstunden und auch am Sonntag geöffnet. Wie sehnsuchtsvoll schauen Sie beispielsweise nach Skandinavien?
Ja, das ist definitiv das große Thema, das ja auch der Deutsche Bibliotheksverband auf Bundesebene verfolgt. Wir versuchen, das derzeit mit Technik auszugleichen, in den Stadtteilbibliotheken in der Vahr und in Vegesack. Das ermöglicht uns, auch in Randzeiten zu öffnen, an allen Wochentagen beispielsweise bis 21 Uhr. Da haben wir uns von den skandinavischen Ländern inspirieren lassen. Was die Sonntagsöffnung angeht: Dafür gibt es keine rechtliche Grundlage, weil die Ausnahmeregelung für öffentliche Bibliotheken nicht greift.
Darüber wird seit Jahren gestritten, und es ändert sich nichts.
In Nordrhein-Westfalen hat man eine rechtliche Lücke genutzt und diese Ausnahmeregelung verändert, in allen anderen Bundesländern gilt das Bundesarbeitszeitgesetz. In Hamburg und Berlin gibt es Sonntagsöffnungen, da behilft man sich beispielsweise mit Agenturen, die ein Veranstaltungsangebot gestalten. Das ist ein sehr emotionales Thema, auch bei uns im Haus. Wir bräuchten auf jeden Fall mehr Personal, um Sonntagsöffnungen abzudecken, es ist also auch eine Ressourcenfrage und vor allem natürlich eine politische Entscheidung.
Wie wichtig finden Sie die Sonntagsöffnung?
Ich würde sie mir wünschen, weil ich sehe, wie wichtig das Thema ist; viele Menschen brauchen die Stadtbibliothek als Ort. Das sieht man daran, wie gut besucht unsere Häuser sind, viele verbringen sehr viel Zeit bei uns. Das sind nicht nur Menschen, die vielleicht wenig Geld zur Verfügung haben, sondern welche, die sich hier und in den Stadtteilbibliotheken gerne aufhalten. Da geht es auch um die Frage: Wo kann ich hingehen, wenn ich einen langen Sonntag vor mir habe und mich alleine woanders nicht wohlfühle? Das ist in einer Bibliothek kein Problem: Hier fällt niemand auf, wenn er alleine kommt.
Was würden Sie sich noch wünschen als weitere Verbesserung für die Stadtbibliothek, was es anderswo schon gibt?
Es wäre gut, noch mehr Raum zur Verfügung zu haben. Wir kommen oft an unsere Grenzen, es kommt regelmäßig vor, dass jemand einen Arbeitsplatz sucht und keinen findet. In anderen Ländern kann man sich in Bibliotheken Räume kostenfrei buchen, um sich beispielsweise mit einer Lerngruppe zu treffen. Es wäre außerdem toll, wenn wir noch mehr anbieten könnten zum Thema Leseförderung für Schulen und Kitas. Unsere Angebote sind immer sehr schnell ausgebucht und unsere personellen Möglichkeiten für die Nachfrage zu knapp. Und ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr Menschen aus Bremen aus tatsächlich allen Lebenswelten erreichen und alle Bremerinnen und Bremer wissen, welche Angebote wir haben, die ihr Leben bereichern können.