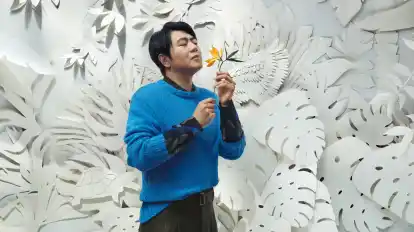Frau Delaforge, Sie stammen aus der Champagne. Darf man eine Vorliebe für das von dort stammende Nationalgetränk bei Ihnen voraussetzen?
Camille Delaforge: Durchaus. Mein erstes Glas trank ich trotzdem erst mit 19 Jahren. Ich mochte es nicht. Inzwischen habe ich meine Meinung geändert.
In Bremen dirigieren Sie Mozarts Bühnenerstling „Die Schuldigkeit des ersten Gebots“, ein „geistliches Singspiel“. Was ist das?
Etwas ziemlich Einzigartiges, es sei denn, man würde es einfach als Oratorium auffassen. Die Sprache Mozarts ist bereits ganz da. Der Einfluss der Oper ist ähnlich stark spürbar wie in den geistlichen Werken des französischen Barock, etwa bei Marc-Antoine Charpentier. In seinem „Requiem“ wird Mozart später zu diesen Anfängen zurückkehren. Sonderlich viele weitere Zeugen des „Geistlichen Singspiels“ sind eigentlich nicht überliefert.
Es war ein Auftrag, und zwar an einen Elfjährigen. Wie ist das nur möglich?
Da hatte der Vater die Finger drin. Leopold Mozart und sein kleiner Sohn befanden sich damals schon auf Tour. Leopolds Hand ist im Autograph durchaus von der seines Sohnes zu unterscheiden. Er hatte den Auftrag an Land gezogen. Leopold bewunderte seinen Sohn und war eindeutig der Erste, der dessen Genie erkannte. Man kann sich das Ganze heute kaum anders als einen kleinen Reise-Zirkus vorstellen. Es war ihr einziger Weg, um zu überleben.
In dem Stück treten die Barmherzigkeit, die Gerechtigkeit und der Weltgeist selber auf. Auch derlei können wir uns heute nicht mehr vorstellen!?
Stimmt, allegorische Werke dieser Art sind vollständig aus der Mode gekommen. Dabei sind sie durchaus zugänglich. Sie thematisieren universale Gefühle wie Wut, Traurigkeit, Verzweiflung und Qual. Es sind große Gefühle, über die man in dieser Form deutlicher sprechen kann, als wir das heute überhaupt noch können. Die Form hatte durchaus ihre Vorteile.
Ein allegorisches Stück wie Hofmannsthals "Jedermann" erfreut sich aus diesem Grund auch heute noch großer Beliebtheit!?
Ganz genau. Der religiöse Inhalt des ersten Gebots kreist noch dazu um die Botschaft, nicht gleichgültig zu sein. So würde ich das mal ganz vorsichtig umschreiben. „Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben“, das ist fast ein Grundsatz des Dogmatismus. Wir sollten allerdings nicht vergessen, dass eine Portion Glauben bei allem eine Rolle spielt, was wir tun. Glauben ist wichtig, weil er sich gegen Indifferenz stellt.
Wenige Leute wissen heute überhaupt noch, was das erste Gebot ist. Kleine Testfrage: Wie lautet das zweite Gebot?
Ich kann Ihnen ehrlich und gutgelaunt sagen: Ich habe keine Ahnung.
Wie sind Sie ausgerechnet auf dieses Werk gekommen?
Ich wollte wohl vorne anfangen. Im Frühwerk ist oftmals immer schon das Ganze enthalten. Ich wollte Mozart dirigieren, und ich wollte etwas anderes machen als die anderen. Ich wurde sofort fündig.
Das Werk bildet nur den ersten Teil eines Dreiteilers, dessen folgende Teile, unter anderem von Michael Haydn, verloren sind. Macht es überhaupt Sinn, diesen Torso separat aufzuführen?
Ja, denn das Werk ist in sich vollständig. Mozart hat es geschrieben, ohne sich um die folgenden Teile zu scheren. Und mit 80 Minuten ist es auch lang genug.
Worin besteht der stilistische Unterschied zum Beispiel zu Joseph Haydn?
Bei diesem Mozart finden wir noch keinen ausgeprägten Orchesterstil. Es geht um Stimmen. Auch kommt bereits der frühe Mozart von der Oper her – und komponiert in diese Richtung. Haydn hat umgekehrt auch bei den Opern vom Orchester her gedacht.
Sie führen das Werk in deutscher Sprache auf, aber mit französischen Sängern?
Total verrückt, wie ich zugeben muss. Das zeigt womöglich, wie sehr ich aus einer französischen Perspektive denke. Dort ist es wichtig, mit dieser Musik bekannt zu werden. Ich bin sicher, dass wir einen gewissen Akzent haben werden. Aber einen schönen, oder?
Warum ist Ihr Ensemble Il Caravaggio nach dem berühmten Barock-Maler benannt?
Aufgrund der Lebensnähe in seinen Bildern. Caravaggio castete Leute von der Straße für biblische Themen. Es geht um echtes Leben. Das gefällt mir. Den Artikel in „Il Caravaggio“ haben wir aufgrund unserer Herkunft. In Frankreich heißt er „Le Caravage“.
Für Caravaggio war das Chiaroscuro, also der kontrastreiche Umgang mit Licht und Schatten maßgeblich. Für Sie auch?
Absolut. Es ist eine in der französischen Kunst nicht unbedingt sehr verbreitete Technik. Da findet man hauptsächlich noch Georges de La Tour, welcher prompt der Gruppe der „Caravaggisten“ zugerechnet wird. Er ist mein anderer Liebling. Bei älterer Musik geht es für mich immer um Theatralität. Ich kam durch Charpentier auf das Thema. Und auf ihn natürlich durch die Entdeckungsarbeit der Aufnahmen von William Christie. Als ich in Paris studierte, war ich geradezu besessen von seiner Musik. So nahm alles seinen Anfang.
Die Alte Musik ist heute keine rein männliche Domäne mehr. Trotzdem findet man nur dort noch echte Divos unter den Dirigenten. Bei traditionellen Orchestern sind die ausgestorben. Wie ist das zu erklären?
Die Antwort liegt auf der Hand: Nur Dirigenten der Alten Musik verfügen über eigene Ensembles. Sie sind es, die ihre Musiker selber engagieren. Außerdem fühlen sie sich durch die Notwendigkeit, ständig neue Sponsoren aufzutreiben, in höherem Grade verantwortlich. Das bleibt nicht folgenlos.
Wie sehen Sie Ihrerseits Ihre Rolle?
Nicht als Diva. Ich bin die einzige Person im Orchester, die unhörbar bleibt. Wir brauchen einander, so einfach ist das. Auch gibt es heute weit mehr Rechte der Orchestermusiker. Daran ist schon mancher Dirigent der Alten Schule mittlerweile gescheitert.
Die meisten Dirigenten der Alten Musik können, schlagtechnisch gesehen, nicht wirklich dirigieren. Wird sich das jemals ändern?
Ich arbeite hart daran. Da ich jahrelang selber im Orchester saß und Cembalo spielte, weiß ich genau, wie schrecklich es ist, sich auf die Zeichengebung eines Dirigenten nicht verlassen zu können. Ich habe sehr darunter gelitten. Und mir geschworen: So nicht. Eigentlich habe ich damals nicht einen einzigen Dirigenten kennengelernt, der das technische Rüstzeug besaß, eine zureichende Schlagtechnik also, um zu zeigen, was er wollte.
Eine Frage, auf die jeder Dirigent eine andere Antwort hat: Was ist der wichtigste Körperteil bei der Ausübung Ihres Berufs?
Dürfen es auch zwei sein? Eigentlich sogar drei? Zwei Füße, um auf dem Boden zu stehen. Und das Herz. Ohne Letzteres geht gar nichts