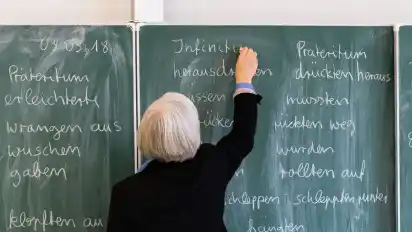Schon als die rot-grün-roten Regierungsfraktionen in ihrem Eckwertepapier zur Haushaltssanierung vorschlugen, die Unterrichtsermäßigung für ältere Lehrerinnen und Lehrer zu halbieren, war dazu kein Wort aus dem Haus von Bildungssenatorin Sascha Aulepp (SPD) zu hören. Dasselbe Spiel, als der Senat darüber noch hinausging und die Altersermäßigung nicht nur reduzierte, sondern kurzerhand komplett strich. Kein Wort aus dem Bildungsressort gegenüber den Medien. Und eine Mitteilung an die Schulen erst, als man sich darüber schon im WESER-KURIER unterrichten konnte.
Schulleitungen bemängeln Kommunikation
Bei den Schulleitungen kommt so etwas schlecht an. "Wir erfahren solche Dinge immer erst aus der Zeitung", sagt Achim Kaschub, Vorsitzender der Schulleitungsvereinigung. "Defizitär" nennt er das Kommunikationsverhalten der Behörde. In den Etagen der Bildungsbehörde rollt man mit den Augen, wenn seine Kassandrarufe zu hören sind. Kein Wunder, immer wieder legt er den Finger in die Wunde. Zuletzt warnte er vor einem "Kollaps" des Bremer Bildungssystems. Seine Befürchtung: Bremen könnte schon sehr bald mit den steigenden Schülerzahlen nicht mehr fertig werden.
Natürlich kann man Kritiker als notorische Nörgler abkanzeln. Doch damit würde man es sich zu einfach machen. Kaum zu leugnen ist: Die Situation ist ernst, an den Schulen kommt es wegen fehlender Lehrkräfte schon jetzt reihenweise zu Unterrichtsausfällen. Das ist eine Situation, die Aulepp nicht allein zu verantworten hat. Zugute halten kann man ihr, dass der Bildungshaushalt im neuen Etatentwurf noch relativ gut wegkommt. Die Frage ist nur: Reicht das, um den Kollaps zu verhindern? Und dabei darf man das andere große Thema nicht vergessen, das Lehrern seit Jahren auf den Nägeln brennt: die gerichtlich angemahnte Erfassung ihrer Arbeitszeit.
Gerade der Umgang mit diesem Punkt hat dazu beigetragen, den Ruf der Behörde unter den Lehrkräften nachhaltig zu beschädigen. Fakt ist: Die Arbeitszeit wird erst im kommenden Jahr systematisch erfasst und das auch nur in einem Pilotprojekt. Das ist weit entfernt von dem, was GEW und Personalrat Schulen gefordert haben, darüber gibt es einen Rechtsstreit.
Die Behörde verkauft das magere Pilotprojekt trotzdem als Erfolg, ja klopft sich selbst sogar als "Vorreiter" auf die Schulter. Kaum anders verhält es sich mit dem Runden Tisch, der nur widerstrebend auf Druck einer Bildungsallianz einberufen wurde. Der große Wurf war er nicht, die Runde doktorte nur ein bisschen an Symptomen herum.
Nach außen erweckte die Bildungsbehörde aber einen anderen Eindruck. Da erschien der Runde Tisch als Krisengipfel. Die Botschaft: Die Senatorin nimmt sich Zeit, sie hört zu. Doch sobald wirklich Ärger droht, fällt die Klappe, oft genug kommuniziert die Behörde noch nicht einmal mit den Schulen. So im Fall des Wegfalls der Altersermäßigung. So auch bei der Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf 41 Stunden für verbeamtete Lehrkräfte. Schlechte Neuigkeiten werden indes nicht besser, wenn man sie verschweigt. Im Gegenteil, ausbleibende Kommunikation fördert das Misstrauen.
So wie bei der 41-Stunden-Woche. GEW und Personalrat haben zwar erstaunlich gelassen reagiert, als die Erhöhung publik wurde. Frei nach dem Motto: egal, Lehrkräfte arbeiten sowieso mehr als vorgesehen. Insofern fällt eine Zusatzstunde gar nicht ins Gewicht – wenn man ohnehin im Schnitt 45 Stunden oder mehr arbeitet. Warum aber eine Erhöhung, wenn sie praktisch keine Auswirkungen hat? Nur weil für Lehrkräfte keine Ausnahme gemacht werden kann, wenn alle Landesbeamten eine Stunde dranhängen müssen?
Das dürfte dahinter stecken. Der Nebeneffekt: Wenn die wöchentliche Arbeitszeit heraufgesetzt wird, verbessert sich automatisch die Versorgung der Schulen. Zumindest auf dem Papier. Dann ist zwar ganz sicher noch nicht das Optimum von 110 Prozent erreicht, um Ausfälle zu kompensieren. Aber ein bisschen besser sieht es schon aus. Das wäre dann wieder Stoff für eine Erfolgsmeldung, die keine ist.