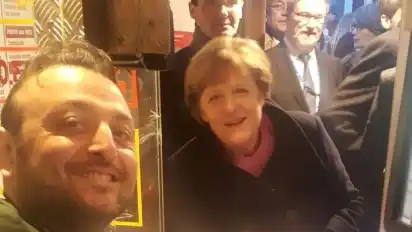Der Flyer des Europa-Punkt Bremen richtet sich offenbar an Jung- und Erstwähler. Ob es die beeindruckt, dass der Waller Sand, der Fischereihafen Bremerhaven und das Geschichtenhaus im Schnoor durch die EU gefördert werden?
Helga Trüpel: Das ist für die 16-Jährigen vermutlich nicht so wichtig. Aber ob sie demnächst noch in einer funktionierenden Demokratie leben, dass die Klimaschutzpolitik noch eine Chance hat, das interessiert sie schon. Und damit argumentiere ich auch in Schulen, nächste Woche in Bremen-Nord.
Zudem gibt es weit größere Beispiele, was in Bremen durch die EU gefördert wird.
Eben. Die ganze Renovierung der Schlachte, Mittel für die Hochschulen über das Forschungsrahmenprogramm Horizon, die Galileo-Programme für die Satelliten von OHB, die Stadtbibliothek . . . Wenn man genauer hinguckt, sind da ganz viele große Projekte, die für alle Bürger irgendwie wichtig sind.
Bremen wird voraussichtlich nach sehr langer Zeit im Europaparlament gar nicht mehr vertreten sein. Wie schlimm ist das?
Das ist sehr bitter. Denn nach Jahrzehnten sitzt dann dort erstmals niemand mehr aus Bremen, ungeachtet der Parteifarbe. Auch wenn wir unsere Bremer Vertretung behalten und über den Bundesrat und den Europaausschuss der Regionen beteiligt sind: Das vor Ort sein, in der Kommission mit den Vertretern zu tun haben, jeden Tag im Parlament zu sein - wenn man das als Person und Abgeordnete nicht mehr zu Hause vermitteln kann, dann ist das ein Verlust.
Mit welchem Gefühl schauen Sie auf den 9. Juni: Zuversicht oder Besorgnis?
Ich schaue mit der Haltung darauf, dass man jetzt ganz viel tun muss, um diese Europawahlen publik zu machen. Und dass man erklären muss, warum der drohende Rechtsruck im Europaparlament zu verhindern ist.
Die jüngste Prognose von Europe Elects sagt den Grünen die stärksten Verluste voraus, zudem könnten sie schwächste Fraktion werden. Worauf führen Sie dies als langjährige Grünen-Abgeordnete zurück?
Zunächst möchte ich feststellen, dass ich heute hier als Vorsitzende der Europa-Union Bremen spreche, also überparteilich.
Aber deshalb können Sie doch etwas zu den Wahlprognosen sagen, quasi aus der Distanz.
Sicher. Die Grünen hatten es ja zuletzt insbesondere in Deutschland in der Auseinandersetzung um das sogenannte Heizungsgesetz alles andere als leicht. Im Europaparlament wiederum haben sie eine Politik gemacht, die nicht immer Bündnisparteipolitik war, wie Robert Habeck das genannt hat. Das große Thema in der EU, das auch die Rechtspopulisten nach oben gespült hat, ist die Migrationspolitik. Da waren die europäischen Grünen immer für maximale Offenheit und minimale Begrenzung.
Ein Fehler?
Ich habe schon als Abgeordnete gesagt, dass man bei dem Thema zwei Säulen bedenken muss: die Aufrechterhaltung des politischen Asyls, aber auch eine gesteuerte Einwanderungspolitik nach Quoten. Die sehr offene Position der Grünen kam in vielen Mitgliedsländern nicht mehr gut an, auch wegen der Alltagsprobleme in Folge der Zuwanderung.
Auch jenseits der Migrationspolitik sind Nationalkonservative und Rechtspopulisten, also Gegner einer umfassenden europäischen Integration, im Aufwind. Hat die EU mit ihren Vorschriften zu oft übertrieben, etwa beim Datenschutz?
Das sehe ich nicht so. Ich fand diese Ansätze im Bereich der digitalen Konzerne und deren Umgang mit persönlichen Daten prinzipiell richtig. Es ist auch richtig, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu regulieren – ohne Wettbewerbsfähigkeit kaputt zu machen. Das ist ja immer die große Herausforderung. Bei der Datenschutzgrundverordnung kann man vielleicht sagen, dass manches im Alltag nicht so praktikabel war, wie der Gesetzgeber sich das vorgestellt hatte.
Aber?
Der Grundgedanke, dass die Menschen die volle Verfügung über ihre Daten haben sollen, bleibt richtig.
Haben das Europaparlament und die EU-Kommission also vor allem ein Kommunikations- und Vermarktungsproblem?
Nehmen wir die Transformationspolitik, den Green Deal, der ja doch von allen pro-europäischen Parteien in Europa mitgetragen wird: Da muss man erklären, wie er im Alltag umgesetzt wird, wie man genug Arbeitsplätze schafft, welche Technologien und Finanzierungsmöglichkeiten eingesetzt werden. Da müssen die Wege klar bezeichnet werden, wie man das Ziel – eine CO2-arme Wirtschaft – erreichen will. Da war die Kommunikation sicher nicht immer perfekt. Es reicht nicht zu sagen, wir sind 2040 oder 2050 klimaneutral.
Die Menschen wollen es konkret, nicht abstrakt.
Genau. Wie werden Stahlwerke umgerüstet, was ist mit der E-Mobilität? Was ist mit den Wärmepumpen, wie bekommen wir genug Photovoltaik-Anlagen auf die Dächer? Wie ist dann die Mischung von staatlichem und privatem Investment, was können die einzelnen Haushalte leisten? Das sind die Fragen, die uns beschäftigen, und da müssen wir bei den Antworten besser werden. Das ist nicht nur ein Problem der Kommunikation, sondern auch der politischen Gestaltung.
In der Landwirtschaft war ja offenbar vieles nicht synchronisiert: Da haben Bauern ihre Ställe guten Willens tierwohlgerecht umgebaut, und dann kam wenig später eine EU-Verordnung, dass es doch nicht ganz reicht.
Da ist das Zauberwort tatsächlich Synchronisation. Es geht um das richtige Verhältnis von Investitionen und bürokratischem Aufwand und Nachweispflichten.
Im Umgang mit rechtspopulistischen Regierungen hat sich die EU nur begrenzt handlungsfähig gezeigt. Eher hatte man das Gefühl, Viktor Orbán, Robert Fico oder vormals auch Mateusz Morawiecki konnten die Union erpressen, etwa bei ihrer Ukraine- oder Migrationspolitik.
Unterm Strich haben wir doch die Unterstützung der Ukraine hinbekommen – trotz der Querschläge von Orbán und Fico. Aber es bleibt natürlich eine große Frage, wie man Länder, die beigetreten sind, zur Einhaltung der etablierten Spielregeln bewegt. Das Beispiel Polen gibt ja Hoffnung. Und ich bin andererseits der Meinung, dass man Serbien nicht aufnehmen darf, solange die Regierung dort derartig mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin kuschelt. Da würden wir uns gleich wieder so ein Problem einhandeln.
Rund 350 Millionen Menschen in 27 EU-Staaten sind zur Wahl eines neuen Europaparlaments aufgerufen. Warum sollte man sich daran beteiligen?
Weil es in einer parlamentarischen Demokratie wichtig ist, die eigene Stimme zu erheben und Mehrheiten zu gestalten. Was in der EU an Gesetzgebung gemacht wird, hat ja im Alltag für jeden von uns Auswirkungen. Wie sind die Grenzwerte bei Abgasen, wie ist das Erasmus-Programm für Schüler und Studenten ausgestattet?
Rund ein Sechstel der EU-Bevölkerung sind Deutsche, Deutschland stellt aber nur knapp ein Siebentel der Europaabgeordneten. Ist das für Sie in Ordnung?
Ja, weil die Länder in der EU so unterschiedlich sind. Wenn man kein Parlament mit 3500 Abgeordneten haben will, das gar nicht arbeitsfähig wäre, aber kleine Länder wie Malta angemessen repräsentieren möchte, gibt es gute Gründe für die aktuelle Gewichtung der Mandate.
In den herrschenden Kriegszeiten scheint die Nato mit ihren 32 Mitgliedern für Deutschland wichtiger zu sein als die EU. Oder was kann Letztere zur Sicherung von Frieden und Freiheit in Europa beitragen?
Auf absehbare Zeit kann sie es jedenfalls nicht alleine machen, sondern sie braucht die Nato. Die Welt hat sich seit der Annexion der Krim vor zehn Jahren und der Vollinvasion Russlands in die Ukraine vor zwei Jahren dramatisch verändert. Wie schützen wir uns selber, wie weisen wir Putin in die Schranken, wie ertüchtigen wir die Ukraine, sich der Aggression zu erwehren und ein selbstständiges, demokratisches Land zu bleiben? Das sind die zentralen Fragen, die wir aber auch ohne die EU nicht beantworten können. Die Sicherheitspolitik muss sowohl europäisch als auch transatlantisch weiterentwickelt werden.
Muss Europa kriegstüchtig werden?
Es muss wehrbereit sein. Und das ist eine ganz bittere Tatsache, denn das Geld, das wir dort hineinstecken, investieren wir eben nicht in Bildungs- und Gesundheitspolitik oder Infrastruktur.
Sie waren 15 Jahre lang selbst Mitglied des Europaparlaments, dort Vizevorsitzende des Kultur- und Bildungsausschusses. Was war rückblickend Ihr größter politischer Erfolg auf EU-Ebene?
Dass es uns gelungen ist, die digitalen Monopolplattformen wie Google mit der Reform des Urheberrechts stärker zu regulieren – gegen die Freiheitsargumente der Piraten-Partei und es Silicon Valley. Das waren sehr harte Auseinandersetzungen.
Die Enteignung von geistigem Eigentum kann man ja eigentlich auch als Liberaler nicht wollen.
Genau das habe ich immer versucht, meinen Kollegen klar zu machen. Das gleiche Thema haben wir bei der Künstlichen Intelligenz. Da hat ja auch unser liberaler Digitalminister Volker Wissing gesagt, dass Künstler und Kulturschaffende da ganz anders geschützt werden müssen. Es muss nachvollziehbar sein, welche Werke wirklich von Menschen geschaffen wurden.
Und was hat Sie besonders frustriert?
Der Austritt Großbritanniens, der Brexit, war schon sehr frustrierend. Gemessen daran, dass man das historisch einmalige Werk der supranationalen europäischen Demokratie weiterentwickeln will.
Das Gespräch führte Joerg Helge Wagner.