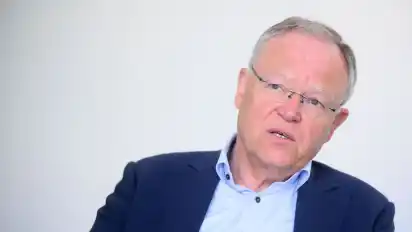Herr Heinemann, beim Länderfinanzausgleich zahlte Bayern allein im ersten Halbjahr 2025 mehr ein, als das Land Bremen jährlich ausgibt: fast 6,7 Milliarden Euro. Ministerpräsident Markus Söder sagt, das könne so nicht weitergehen. Haben Sie Verständnis für ihn?
André Heinemann: Nein. Der Finanzausgleich macht exakt das, was 2017 vereinbart wurde und was auch die Vertreter Bayerns im Bundesrat so mitgetragen und als „bleibender Erfolg für den Föderalismus“ bezeichnet haben. Ja, das Gesamtvolumen im Finanzkraftausgleich steigt, weil aber auch die Steuereinnahmen insgesamt trotz anhaltender Wirtschaftsschwäche steigen. Wenn man den Umfang des Finanzkraftausgleichs ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt setzt, ist dieses Verhältnis seit 2020 nahezu gleichgeblieben.
Aber Bayern zahlt immer mehr ein.
Das liegt daran, dass Bayern so enorm stark ist – auch im Vergleich zu den anderen finanzstarken Ländern Hessen, Baden-Württemberg und Hamburg. Und im Frühjahr 2025 gab es einen außerordentlichen enormen Sondereffekt in Bayern bei der Erbschaftsteuer.
Bayern hat 2023 abermals eine Klage gegen den Finanzausgleich beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Wie sind die Erfolgsaussichten?
Interessant ist, dass Bayern nach einem gefundenen Kompromiss erneut klagt. Nicht zum ersten Mal, manchmal beteiligen sich wie 2013 oder 1998 andere finanzstarke Länder daran. In dem Schriftsatz von 2023 wird die Einwohnerwertung (jene der Stadtstaaten werden mit 135 Prozent gewichtet, die Redaktion) nicht grundsätzlich infrage gestellt, nur die Höhe beziehungsweise die Berechnungsmethode. Zudem wird gefordert, den Haushalt eines finanzstarken Landes mit nicht mehr als zehn Prozent zu belasten. Wenn man in Bayern aber auch die finanzstarken Kommunen mit einberechnet, was sachgerecht ist, liegt die Belastung unter zehn Prozent. Man kann vielleicht über die methodische Problematik reden, dass man bei einem unterdurchschnittlichen Satz bei der Grunderwerbsteuer den durchschnittlichen Satz angerechnet bekommt und dadurch finanzstärker wirkt – obwohl man ja nicht mehr Einnahmen hat.
Das erscheint in der Tat ungerecht.
Ja, aber das ist eine eher kleine Thematik. In der Summe sehe ich keinen tragenden Hinweis darauf, dass das Bundesverfassungsgericht unweigerlich zu der Annahme kommen müsste, der jetzige Finanzkraftausgleich sei verfassungswidrig.
Bremen erhielt 2024 als Nehmerland aus dem Finanzkraftausgleich fast 925 Millionen Euro.
Und dann kommen noch die Bundesergänzungszuweisungen hinzu. Aber genau genommen haben wir keine Geber- und Nehmerländer mehr.
Das müssen Sie bitte erklären.
Wir haben Länder, die bei der Umsatzsteuerverteilung Abschläge erleiden, wenn sie zu finanzstark sind. Und wir haben finanzschwache Länder, die bei der Umsatzsteuerverteilung Zuschläge bekommen. Das Geben und Nehmen zwischen den Ländern existiert seit 2020 nicht mehr – also, dass man aus eigenen Mitteln noch etwas abgeben musste.
Ihr Heidelberger Kollege Friedrich Heinemann – kein Verwandter – kritisiert am Sondervermögen für Klimaschutz und Infrastruktur, dass es nicht in ein Gesamtpaket aus Sozialstaatsreformen und unabhängiger Überwachung eingebettet wurde. Deshalb werde gar nicht in die Zukunft investiert, sondern Milliarden für Gegenwartsinteressen und Transfers verpulvert.
Diese Einschätzung teile ich nicht in Gänze, aber etliche Finanzwissenschaftler haben bei der Anhörung des Haushaltsausschusses vor Kurzem diesen Punkt aufgegriffen. Übrigens völlig unabhängig davon, von welcher Partei sie benannt wurden. Sie sagen, dass ein Sondervermögen zwar gut in die Zeit passt, dass aber auch genau darauf geachtet werden muss, wofür diese Mittel eingesetzt werden. Nämlich für zusätzliche, wirtschafts- und finanzkraftstärkende und auch noch klimaschützende Investitionen. Man befürchtet, dass zumindest ein Teil doch auf gesetzlichen Umwegen in die konsumtiven Ausgaben fließt. Das aber würde wiederum die Wachstumschancen reduzieren.
Man könnte es auch Schattenhaushalt nennen.
Es geht um die Verwendung von Krediten. Die sollten das Wachstum so fördern, dass man aus zusätzlichen Wachstumserträgen die Kredite auch refinanzieren kann. Werden aber aus dem Bundeshaushalt Investitionen nur in das Sondervermögen umgeschichtet, dann können die frei werdenden Bundesmittel im konsumtiven Teil verbraucht werden, etwa mittelbar zur Finanzierung der Mütterrente. Auch im Verteidigungshaushalt haben wir überwiegend konsumtive Ausgaben, nämlich für das Personal. Der erforderliche Aufwuchs sollte auch finanziert werden – aber nicht über Kredite im Rahmen der Bereichsausnahme, sondern überwiegend über Steuereinnahmen.
Bald beginnt eine Kommission zur dauerhaften Reform der Schuldenbremse mit ihrer Arbeit. Wenn Sie Mitglied wären: Was wäre Ihre wichtigste Forderung?
Sowohl beim strukturellen Verschuldungsspielraum für den Bund als auch beim neuen strukturellen Verschuldungsspielraum für Länder sollte grundgesetzlich vorgegeben werden, dass dies ausschließlich für Investitionen gilt. Das taucht im Gesetzentwurf für die neue Länderschuldenbremse aber aktuell nicht auf. Noch besser wäre sogar, sich an den Netto-Investitionen zu orientieren, also abzüglich des Aufwandes, den ich habe, um mein Vermögen zu erhalten. Dies wäre aus meiner Sicht ein Punkt, der auch in Bremen im Rahmen einer Landesverfassungsänderung diskutiert werden sollte.
Wie viel würde denn für Bremen jetzt mit der neuen Länderschuldenbremse an weiteren Krediten möglich?
Das ist etwas kompliziert, denn die 0,35 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, das entspricht etwa 15 Milliarden Euro für die Ländergesamtheit, werden nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt. Der berücksichtigt neben der Einwohnerzahl auch die jeweilige Steuerkraft. Für Bremen bleibt danach knapp ein Prozent, also rund 140 bis 150 Millionen Euro pro Jahr. Und das ohne jegliche Investitionsbindung, was ich kritisiere.
Bremens Kredittopf namens Notlage-Sonderfonds, um längerfristig Folgen des Ukrainekrieges und der Klimakrise zu finanzieren, wurde vom Bundesverfassungsgericht kassiert. „Schulden auf Vorrat“ für mehrere Jahre sind passé – die Kontrolle funktioniert also doch, oder?
Ja, da musste dann der Gesetzgeber, die Bürgerschaft, noch einmal nachdenken. Also hat man einen neuen Fonds in die Landesverfassung aufgenommen. Kreativ und formal in Ordnung. Wenn aber für das Stahlwerk ein Teil nicht mehr benötigt wird, bleibt die Frage, wie man mit der entsprechenden Kreditermächtigung umgeht.
Andererseits klaffen Haushaltslöcher, unter anderem durch die hohen Defizite von Bremer Straßenbahn AG und Gesundheit Nord. Könnte sich das Land nicht einfach von diesen Verlustbringern trennen?
Das sehe ich überhaupt nicht. Den ÖPNV sollte man als Daseinsvorsorge sehen, und dann kann auch akzeptiert werden, dass sich Teilleistungen, zum Beispiel bestimmte Linien, nicht immer betriebswirtschaftlich rechnen, was zu Defiziten führt. So auch bei Krankenhäusern.
Das klingt etwas schicksalhaft.
Gar nicht, denn es ist eine Standardaufgabe, die Strukturen zu untersuchen, um die Defizite zu minimieren. Der muss sich die Politik auch in Bremen stellen, es darf keinen Freifahrtschein für Defizite geben. Aber wenn sich der Staat dieser Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger einfach entledigt, verliert er an Qualität und an Legitimation. Da sollte man sich lieber anderes anschauen. Ist zum Beispiel die Bremer Freikarte angesichts der aktuellen Finanzlage wirklich notwendig?
In Bremen ist vieles marode: Brücken, Schul- und Unigebäude, Polizeiwachen. Zudem gibt es einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Transferempfängern in der Bevölkerung. Schulden sind unvermeidlich, richtig?
Das ist genau das Dilemma. Bremen muss pro Jahr etwa eine halbe Milliarde Euro nur für Zinsen aufwenden. Wir haben eine weit überdurchschnittliche Verschuldung pro Kopf. Auf der anderen Seite müssen staatliche Aktivitäten finanziert werden, für die die steuerlichen Mittel in Bremen allein nicht reichen. Da hilft es natürlich, dass aus dem Fonds für Infrastruktur und Klimaneutralität 100 Milliarden Euro für die Länder vorgesehen sind. Für Bremen rund 80 Millionen pro Jahr. Die sind zwar leider nicht an zusätzliche Investitionen gebunden, aber die Zins- und Tilgungslasten übernimmt der Bund. Das ist eine gewaltige Entlastung. Hinzu kommt, dass der Bund mit seinen Mitteln in Ländern und Kommunen investieren wird – da wird also auch noch einmal etwas in Bremen hängen bleiben.
Das Gespräch führte Joerg Helge Wagner.
André W. Heinemann (54) ist Professor für bundesstaatliche und regionale Finanzbeziehungen an der Universität Bremen. Von 2018 bis zum Kriegsausbruch lehrte er zudem als "Visiting Professor" an der Nationalen Wadym-Hetman-Wirtschaftsuniversität Kiew. Seit 2001 ist Heinemann Mitglied der Grünen.