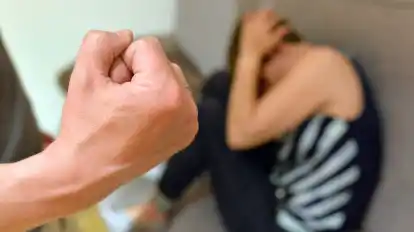„Wir sind zurzeit voll belegt“ – diesen Satz hören Frauen, die Schutz vor einem gewalttätigen Partner oder Ex-Partner suchen, immer häufiger. Die Frauenhäuser in Deutschland sind überlastet. Das ist auch in Bremen der Fall, obwohl die Zahl der Plätze in den Einrichtungen bereits aufgestockt wurde.
„Bei uns ist ein Zimmer nie länger als einen Tag oder eine Nacht frei“, berichtet Dagmar Köller, Einrichtungsleiterin im Frauenhaus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Bremen. Das Haus verfüge über 38 Plätze mit 15 Zimmern für Frauen. Viele von ihnen kommen mit Kindern, daher die höhere Platzzahl. Seit der Pandemie bewege sich die Auslastung im Schnitt bei 98 Prozent, „So dauerhaft hatten wir das noch nie“, sagt die Leiterin.
Das hat Folgen: „Der schlimmste Moment ist, wenn wir Schutz suchende Frauen abweisen müssen“, sagt Köller. Dies komme regelmäßig vor: An 21 aufeinanderfolgenden Tagen, in denen das Awo-Frauenhaus in der Zeit von 16.30 Uhr bis 8 Uhr morgens in Rufbereitschaft gewesen sei, hätten 26 Frauen nicht aufgenommen werden können. In diesen Fällen werde versucht, in einem anderen Bremer Frauenhaus oder in anderen Städten wie etwa Hannover Zimmer zu organisieren.
Die Lage sei aber überall schwierig. Mittlerweile gebe es Häuser, die nur noch Frauen aus der näheren Umgebung aufnähmen, etwa auch in Niedersachsen. „Das sind katastrophale Folgen für die Betroffenen, die alle Kraft und Mut zusammengenommen haben, um sich und ihre Kinder aus dem gewalttätigen Umfeld zu retten“, sagt Köller.
Frauen sollen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung bekommen
Im Land Bremen gibt es aktuell 125 Plätze in Frauenhäusern, 113 in drei Einrichtungen in der Stadt Bremen. Das Frauenhaus Bremerhaven verfügt laut der Gesundheitsbehörde über zwölf Plätze plus Plätze für Kinder, die nicht extra ausgewiesen werden. Ab September sollen in Bremen acht und ab März 2024 sieben Plätze hinzukommen, teilt Pressereferentin Diana Schlee mit. Ziel seien mindestens 160 Plätze im Land. Hintergrund neben dem großen Bedarf ist die Istanbul-Konvention: Mit dem internationalen Übereinkommen hat sich Deutschland verpflichtet, Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen.
Bundesweit ist die Lage für Frauen, die Schutz in Frauenhäusern suchen, heikel: Nach einer Auswertung des Investigativmediums "Correctiv" meldeten die Frauenhäuser im Schnitt an 303 Tagen, dass keine Aufnahme mehr möglich war. In die Auswertung flossen Daten von 200 Häusern aus 13 Bundesländern aus dem Jahr 2022 ein. In Deutschland gibt es etwa 400 Frauenhäuser mit knapp 8100 Plätzen.
Künftig sollen von Gewalt betroffene Frauen einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung haben, dazu will das Bundesfrauenministerium von Lisa Paus (Grüne) einen Gesetzentwurf vorlegen. Ziel sei, dass es am Ende mehr Frauenhäuser und Beratungsstellen gebe. Ein flächendeckendes Netz gibt es bisher nicht. Der Bund soll auch bei der Finanzierung einsteigen, Frauenhäuser und Beratungsstellen sind bisher in der Verantwortung von Ländern und Kommunen.
„Hier muss der Bund endlich liefern“, fordert Bremens Frauensenatorin Claudia Bernhard (Linke). Dabei dürfe aber nicht nur das Minimum finanziert werden, bestehende hohe Standards in den Ländern und Kommunen müssten erhalten bleiben. „Alle Frauen müssen außerdem davon befreit werden, für ihren Gewaltschutz selbst zu bezahlen, unabhängig von Einkommen und Ersparnissen“, betont Bernhard.
Einige Frauen leben bis zu anderthalb Jahren im Frauenhaus
Bisher setzen Frauen zunächst ihr eigenes Einkommen oder Vermögen für den Aufenthalt im Frauenhaus ein – sie zahlen also selbst. Ansonsten kann ein Antrag beim Jobcenter oder Sozialamt gestellt werden. Allerdings: In eine Lücke fallen Frauen, die weder eigenes Geld noch Anspruch auf Sozialleistungen haben – wie etwa Studentinnen, Schülerinnen, EU-Bürgerinnen oder Frauen ohne Aufenthaltsstatus. Bremen hat für diese Fälle einen Sondertopf in Höhe von 30.000 Euro bereitgestellt. „Daraus wird ein Teil der Differenz getragen, das reicht aber nicht aus“, sagt Köller. So komme es auch vor, dass Mitarbeiterinnen privat für Einkäufe zusammenlegten.
Die Frauen lebten häufig sehr lange in den Einrichtungen, bis zu einem oder anderthalb Jahren, berichtet Köller. Zum einen, weil die Bedrohungssituation weiterhin akut sei. „Erschwerend kommen gestiegene Mieten und Wohnungsnot hinzu“, berichtet eine Mitarbeiterin des Autonomen Frauenhauses in Bremen, die zum Schutz der Frauen in der Einrichtung ihren Namen nicht veröffentlicht sehen möchte. „Das trägt zu der angespannten Situation in den Frauenhäusern bei. Es gibt einfach zu wenige Plätze.“