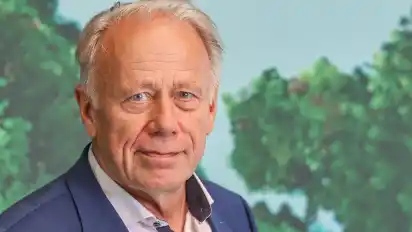Herr Trittin, Sie sind Bremer und wie man hört, in letzter Zeit wieder häufiger in der Stadt, um 70. Geburtstage alter Weggefährten zu feiern. Ist das so?
Jürgen Trittin: Ich bin gerne bei meinen Bremer Freunden.
Wie ist die Stimmung auf diesen Geburtstagsfeiern? Fröhliches Wiedersehen oder allgemeine Betrübnis angesichts der Lage der Grünen?
Ich erlebe da keine Trübsal – es ist doch schön, so etwas zusammen zu feiern. Aber richtig ist: Wir müssen uns mit einer Realität auseinandersetzen, in der wir – parallel zum ökonomischen Siegeszug der Energiewende, die wir auf den Weg gebracht haben – ein lobbygetriebenes und ideologisches Rollback erleben. Und das ist nicht auf Deutschland beschränkt. Die größte Gemeinsamkeit zwischen Trump und Putin ist doch: Sie benutzen fossile Energien, um ihre geopolitische Stärke zu untermauern. Wenn sich Europa und China davon unabhängig machen, gefällt das Trump natürlich nicht – deshalb erleben wir dieses Rollback.
Sie sind ein Grüner der ersten Stunde, Parteimitglied seit 1980 – grünes Urgestein, sozusagen. Jetzt sind Klima- und Umweltschutz in der politischen Debatte weltweit in der Defensive. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass da gerade etwas zerbricht, wofür die Grünen mehr als 40 Jahre lang gestritten haben?
Es gibt diese Auseinandersetzung, ja. Meine Sorge ist aber eine andere: Grüne Technologien wie Wärmepumpe und E-Auto werden sich durchsetzen, weil sie effizienter sind als fossile Technologien. Aber wir sind dabei, das zu wiederholen, was wir 2011 schon einmal gemacht haben: Damals haben die verantwortlichen Minister Rösler von der FDP und Altmaier von der CDU einen Deckel auf die Fotovoltaik gelegt. Die Technik hat sich trotzdem durchgesetzt, aber die Module kommen nicht mehr aus Sachsen und Sachsen-Anhalt, sondern aus China. Wenn wir jetzt also der verbreiteten Stimmung gegen grüne Technologien nachgeben, passiert das Gleiche noch einmal: Dann werden wir viele E-Autos haben, aber keine europäische Autoindustrie mehr; wir werden mehr Windräder haben, die aber aus China kommen. Dann hätten wir uns von Putins und Trumps Öl und Gas unabhängig gemacht – sind aber abhängig von chinesischer Technologie. Das kann keiner wollen.
In den Wahlergebnissen macht sich Ihr Optimismus zur Durchsetzbarkeit der grünen Ideen nicht so bemerkbar: Vor wenigen Jahren lagen die Grünen in Umfragen bei 25 Prozent und hatten die Hoffnung, die nächste Bundeskanzlerin zu stellen – jetzt steht dort die AfD und Ihre Partei bei unter zwölf Prozent.
Bei Wahlen hatten wir noch nie 25 Prozent, das beste Ergebnis war 2021 mit 14,7 Prozent. Aber ja: Es gibt eine Delle, die wir noch nicht überwunden haben. Die Grünen müssen lernen, dass Klima- und Umweltschutz keine Konsensthemen mehr sind. Das war vor 20 Jahren anders. Heute polarisieren diese Themen, und dem müssen wir uns stellen. Ich glaube aber, wir haben in Deutschland gute Voraussetzungen, diese ganz Europa erfassende Herausforderung zu meistern: Es gibt hier eine lagerübergreifende Kultur der Mitte – anders als etwa in Frankreich, wo an diesem Gegensatz gerade eine Regierung zerbricht. Und es gibt in Deutschland die Erfahrung, dass man mit der ökologischen Transformation Geld verdienen kann. Was ein Bremer Unternehmer wie Klaus Meier heute in die Entwicklung der Überseeinsel steckt, hat er zuvor unter anderem mit seinen Windparks verdient.
Ist denn das, was wir bei den Wahlergebnissen für die Grünen und die AfD sehen, aus Ihrer Sicht nur das übliche Auf und Ab in der politischen Stimmung oder schwingt hier gerade ein großes Pendel in die andere Richtung – weg vom „rot-grün versifften Mainstream“ nach ganz rechts, wie die AfD meint?
In den mehr als 40 Jahren, die ich jetzt bei den Grünen bin, sind wir schon so oft für tot erklärt worden – da bin ich nicht bange. Nach dem Abgang unserer bekanntesten Gesichter – Annalena Baerbock und Robert Habeck – müssen wir jetzt natürlich neue Führungsfiguren aufbauen. Und dass eine Partei, die drei Jahre lang ihre Regierungsfähigkeit beweisen musste, jetzt erst mal wieder in ihre Oppositionsrolle finden muss – das ist normal. Das haben wir nach dem Ende von Rot-Grün 2005 auch gemacht und 2009 unser bis dahin bestes Wahlergebnis erzielt. So etwas ist jetzt auch wieder möglich.
Wie nehmen Sie die Stimmung in der Partei wahr? Man hört hier und da von Verzweiflung und Ratlosigkeit.
Meine Fraktionsvorsitzenden haben gesagt: Man muss wissen, von wo der Wind weht, und wenn er einem ins Gesicht weht, muss man trotzdem stehen bleiben. Diese Haltung müssen wir wieder lernen. Viele der Jüngeren von uns sind groß geworden mit der Auffassung: Alle wollen grün sein. Die Erfahrungen meiner Generation, dass wir uns erst mal gegen alle durchsetzen mussten, haben die Jüngeren nicht hinter sich. Jetzt müssen wir lernen: Die Ökos sind eines der drei Hassobjekte der globalen Rechten – neben farbigen und diversen Menschen. Dem müssen wir uns stellen – wir sind nicht mehr Everybody’s Darling. Aber wir können diesen Kampf gewinnen.
Viele Menschen fühlen sich von grüner Politik bevormundet und gegängelt; Ihnen haftet das Image der „Verbotspartei“ an. Was haben die Grünen falsch gemacht?
Die Grünen sind mit dem Kampf gegen Bevormundung und für Selbstbestimmungsrechte groß geworden. Deutschlands Verbotspartei ist die CSU in Bayern: Dort werden Beamte, Lehrer, Hochschullehrer disziplinarrechtlich verfolgt, wenn sie eine bestimmte Sprache sprechen.
Gerade das Gendern wird aber von sehr vielen als Bevormundung empfunden.
Dann können sie es lassen, sie werden deshalb nicht bestraft – anders als in Bayern: Da werden sie bestraft, wenn sie gendern. Herr Söder ist ein Verbotspolitiker. Am liebsten hätte er Wurstzwang für alle. Was die Grünen falsch gemacht haben, ist: Sie haben sich dieser aufkommenden Polarisierung zu spät gestellt. Wir haben immer geglaubt: Wenn die Wissenschaft sagt, dass eine Aufheizung der Atmosphäre um so und so viel Grad die und die Folgen hat, dann muss das doch jeder einsehen. Dass diese Einsicht in die Wissenschaft wichtig, aber nicht ausreichend ist für Politik, das müssen wir wieder lernen. Es geht immer auch um Ängste, aber auch um positive Emotionalisierbarkeit: Es ist doch schön, in einem autofreien Stadtviertel zu leben, in dem mein Kind nicht Gefahr läuft, umgefahren zu werden.
Aber muss Klimaschutz zwangsläufig mit dem Kulturkampf verbunden sein, den auch die Grünen führen? Viele Leute wären vielleicht bereit, ihr Auto mal stehenzulassen, ohne sich deshalb als „Radfahrende“ oder „Zufußgehende“ bezeichnen zu wollen.
Das machen ja viele – ihr Auto stehen lassen und mit dem Fahrrad zum Einkaufen fahren. Das geht alles. Und genau das sind diese Positivbeispiele, von denen wir mehr reden müssen.
Aber die Grünen kommen dann mit queeren Ampelfiguren, statt sich mit einer Verbesserung des Radwegenetzes zu begnügen.
Das ist nicht verkehrt, aber es gibt sicherlich wichtigere Themen.
Lässt sich die „grüne Transformation“ noch retten?
Wir erleben, wie gesagt, weltweit ein massives Rollback, das von der Fossillobby betrieben wird. Nicht nur Elon Musk hat ja Trump im Wahlkampf unterstützt – die fossile Industrie hat 450 Millionen Dollar in dessen Kampagne gesteckt. Das war gut investiertes Geld, denn die Öl- und Gasindustrie bekommt das jetzt über Steuererleichterungen hundertfach zurück. Das ist die Auseinandersetzung, die wir führen. Ob wir die gewinnen, weiß ich nicht. Aber wir können sie gewinnen, auch weil wir die besseren ökonomischen Argumente haben.