Wie sollten Jugendliche heute etwas über den Nationalsozialismus lernen: Anhand von Fotos von Tätern, die ausgehungerte Opfer im Konzentrationslager zeigen? Oder durch selbst gemachte Zeitschriften, in denen junge Menschen in Theresienstadt ihren Alltag und ihre Wünsche gezeichnet und aufgeschrieben haben?
Schulbücher sollten Menschen, die in der NS-Zeit verfolgt wurden, nicht nur als passive Opfer zeigen, und nicht aus der Sicht der Täter, sondern anhand ihrer eigenen Fotos und Dokumente. Das fordern die Wissenschaftlerinnen Meral El und Lena Prötzel. Sie haben sich damit befasst, wie die gewaltsamsten Kapitel deutscher Geschichte in Bremer Schulbüchern dargestellt werden.
Die Berliner Kulturwissenschaftlerin Meral El hat im Auftrag der Bremer Landeszentrale für politische Bildung zehn Schulbücher begutachtet. Diese Bücher sind in in der Hansestadt für den Lernbereich Politik und Gesellschaft in der neunten und zehnten Jahrgangsstufe zugelassen und wurden zwischen 2013 und 2020 herausgegeben. In der neuen Studie, die in der Landeszentrale vorgestellt wurde, geht es um die Frage, ob die Bücher Rassismus und Diskriminierung angemessen aufgreifen. Die Studienautorin stellte bei ihrer Untersuchung unter anderem die Frage: Wie wird Geschichte in den Büchern erzählt? Welche Perspektiven kommen vor, welche fehlen? Besonders intensiv sah sich die Forscherin dabei die Kapitel zur Kolonialgeschichte und zum Nationalsozialismus an.
Viel Nazi-Propaganda, wenig Gegenbilder
Basis für die Studie war ein Beschluss der Bürgerschaft, dass es eine diskriminierungskritische Analyse von Bremer Schulbüchern geben sollte. Die Landeszentrale für politische Bildung sorgte für die Umsetzung und beauftragte die Berliner Kulturwissenschaftlerin Meral El. Sie war bis 2021 Geschäftsführerin des postmigrantischen Netzwerks Neue deutsche Organisationen und arbeitete zuvor unter anderem im Jüdischen Museum in Berlin und für die Organisation Save the Children. Die Historikerin Lena Prötzel von der Landeszentrale entwickelte gemeinsam mit Meral El das Studien-Design und wirkte bei ergänzenden Gesprächen mit Jugendlichen und Expertinnen mit, die Teil der Studie sind.
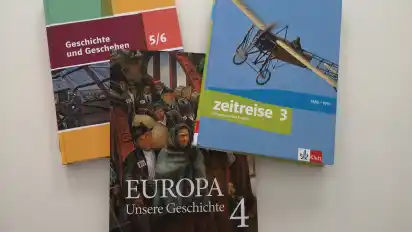
Die Berliner Kulturwissenschaftlerin hat insgesamt zehn in Bremen zugelassene Schulbücher untersucht - hier sieht man drei davon.
Immer wieder würden Abbildungen der Nazi-Propaganda in den Büchern wiedergegeben, stellte Meral El fest – oft ohne Gegenbilder, die Perspektiven von Verfolgten zeigen. So werde in gleich zwei Schulbildern die Abbildung "Der ewige Jude" von 1937 gezeigt – eine antisemitische Zeichnung, die Teil der NS-Propaganda war. Auch Porträts von Adolf Hitler und seiner Selbstinszenierung gebe es seitenweise. Dagegen kämen Roma und Sinti und schwarze Menschen und ihre Beteiligung am Widerstand gegen den Nationalsozialismus kaum vor. Nur vereinzelt und meist sehr kurz würden individuelle Fotos und Lebensgeschichten von NS-Verfolgten gezeigt, zum Beispiel ein Bild des sinto-deutschen Boxers Johann Trollmann.
Stattdessen sehe man in den Schulbüchern Bilder von Menschen, die in Ketten vor ihren Kolonisatoren niederknien. Und Aufnahmen von ausgehungerten nackten Menschen vor Konzentrationslagern, die von den Tätern gemacht wurden. "Ich war an vielen Stellen wütend, dass immer noch junge Menschen diese gewaltvollen Bilder sehen müssen", beschrieb Meral El ihre Eindrücke bei der ersten Durchsicht der Bücher. "Um zu wissen, dass ein Mord begangen wurde, muss man nicht zuschauen", sagte sie. Heute werde die gewaltvolle deutsche Geschichte andernorts oft bereits mit ganz anderen Mitteln erzählt: Viele Museen hätten sich auf den Weg gemacht und würden diese Bilder nicht mehr zeigen. "Die Frage ist, ob Personen entmenschlicht mit dem Blick der Täter gezeigt werden", sagte Lena Prötzel.
Forscherin fordert neues Lehrmaterial
Auch einige Positiv-Beispiele benennt die Studie. Zum Beispiel gebe es in einem der Schulbücher die Aufgabenstellung für Schülerinnen und Schüler, Interviews mit ehemaligen Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern in ihrem Umfeld zu führen. Ein guter Ansatz, hier werde multiperspektivisch auf das Thema geschaut, heißt es in der Studie. Ganz anders die Aufgabe zum Thema Antisemitismus, die ein anderes Buch vorschlägt: Dort werden die Schüler aufgefordert, Vorurteile über Juden zusammen zu tragen. Damit würden antisemitische Vorurteile im Klassenraum wiederholt, sagte Meral El.
Mit Blick auf ihre Studienergebnisse stellte die Forscherin fest: Eine Überarbeitung der Schulbücher reiche nicht aus. Im Grunde werde komplett neues Unterrichtsmaterial gebraucht, gerne in digitaler Form statt als schwere Wälzer, sagte Meral El. Für die Erarbeitung neuen Lehrmaterials sollten sich die Buchverlage von Anfang an Expertise von Organisationen der Zivilgesellschaft holen, empfahl die Forscherin.
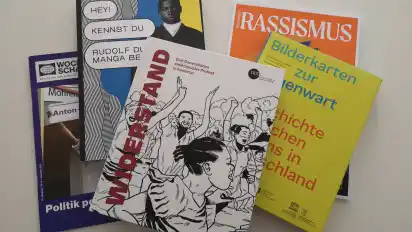
Es geht auch anders: Die Wissenschaftlerinnen Meral El und Lena Prötzel verweisen auf neuere Bücher zu Rassismus und Kolonialgeschichte, die mit modernen Konzepten und verschiedenen Perspektiven auf diese Themen blicken. Hier sieht man Beispiele für die von ihnen empfohlenen Werke.






