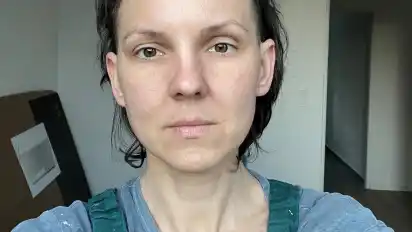Was gefällt Ihnen besonders gut an Bremen?
Diese Mischung aus Stadt und Dorf. Sehr grün, überall ist es mit dem Fahrrad nah, diese Stadt ist für die Menschen und nicht nur für die Autos gemacht. Die Straßen mit kleinen Häuschen erinnerten mich gleichzeitig an die Gegend von Dolores-Park in San Francisco. Dazu noch die nette Atmosphäre auf den Trödelmärkten und Straßenfesten. Man kennt sich gefühlt über vier Ecken. Ich habe immer das Gefühl, das Wetter ist schlecht, aber dafür ist das soziale Klima toll. Ich hoffe, es bleibt so.
Was schätzen Sie am meisten an Deutschland?
Schwere Frage, so allgemein. Ich kann selbstverständlich keine Aussage über ganz Deutschland treffen. Wenn ich es versuchen soll, dann ist es die Offenheit. Offenheit gegenüber schweren Themen, Offenheit gegenüber Kritik. Und das Deutschland eine – wie ich es erlebt habe – inklusive und vor allem kritische Gesellschaft ist, die nicht Angst hat, für demokratische und ethische Werte in die Straßen zu gehen und die Meinung zu äußern. Vielleicht ist es Teil der „kollektiven Schuld“, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg trägt, wie es Karl Jaspers beschrieben hatte, das kann ich nicht beurteilen. Wichtig ist, dass trotz des rechtsradikalen Rückschlags, den wir gerade überall in der Welt sehen, die Offenheit, aus der Vergangenheit zu lernen und die Vorsicht, nicht noch einmal diese Fehler zu machen, hier immer noch präsent ist.
Was könnte in Deutschland besser werden?
Das eben Gesagte kann immer eher als ein Prozess gesehen werden und verbessert werden – also die Offenheit und die Vorsicht, nicht zu vergessen und aus der Geschichte zu lernen.
Was ist für Sie typisch deutsch, was typisch slowakisch?
Typisch deutsch versus typisch slowakisch wäre etwas wie: Gerechtigkeit ist ein langer Prozess und ein komplexes Regelwerk, das möglichst viele Perspektiven mit einbeziehen soll, versus Gerechtigkeit dient vor allem denen an der Macht und es gibt nicht mal einen Versuch, dies zu vertuschen.
Welche Unterschiede stellen Sie zwischen der Mentalität der Deutschen und der Slowakei fest?
Ich habe das Gefühl, dass die Slowakinnen und Slowaken impulsiver sind. Das kann in vielen Aspekten ganz positiv sein, aber hat auch negative Seiten, vor allem, was Unüberlegtheit und Aggressivität betrifft. Am meisten merke ich das an der Sprache. Einfach, weil die slowakische Sprache viel mehr und viel krassere Schimpfwörter hat, die ganz alltäglich gebraucht werden.
Was vermissen Sie aus Ihrer Heimat?
Die Berge und kristallklare Seen. Und die Familie.
Können Sie sich vorstellen, für immer in Bremen zu bleiben?
Ja, tatsächlich sehr gerne. Ich habe hier eine tolle Basis, einen Job und Kolleginnen und Kollegen, die Offenheit, gegenseitige Unterstützung und Respekt total ausleben. Wir haben das Glück, ein gemütliches Häuschen zu haben, nette Nachbarschaft und einen großen Freundeskreis. Mit meinen Freundinnen haben wir uns sogar die „eigenen Zimmer“ eingerichtet – unsere Risographie und unser Design-Studio, die feministische D.O.C.H.-Künstlerinnengruppe. Ist nur schade, dass die Familie so weit weg ist. Gerade jetzt, wo wir eine kleine Tochter haben und die Großeltern unsere Nähe und Hilfe bräuchten, wie wir die ihre, fühlt man die Distanz schon.
Was bedeutet die EU für Sie?
Vor 15 Jahren war es vor allem die Freiheit, diese Distanz zu minimieren und zu reisen. Ich bin aus der Generation, die noch ganz kurz die Okkupation in der Slowakei miterlebt hat, beziehungsweise, dass die Familienmitglieder, die emigriert waren, keinen Kontakt mehr nach Hause haben durften. Aber die EU ist auch viel mehr als das. Sie ist ein Schutz, ein wichtiger Garant für Demokratie und Weiterentwicklung. Gerade spüre ich das ganz intensiv, weil die Slowakei um den Rechtsstaat kämpft unter dem Druck einer korrupten Regierung. Für die Slowakei ist die EU eine große Hoffnung, akut vielleicht sogar die letzte Hoffnung, dass es nicht als eine Autokratie endet.