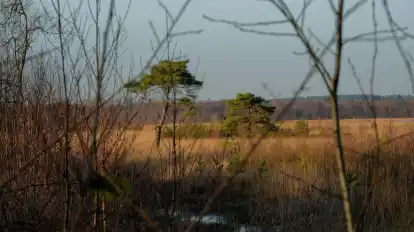Wie können Bremer Landwirte auf Grünflächen mit Mooranteil die Freisetzung von Treibhausgasen einschränken und sie gleichzeitig bewirtschaften? Um Antworten auf diese Frage zu finden, sammeln die Mitarbeiter des Grünlandzentrums Niedersachsen/Bremen ab sofort Daten im Bremer Blockland. Kathrin Moosdorf (Grüne), Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft, stellte das Forschungsprojekt "Green Moor II" am Dienstag vor.
Wo liegt das Problem?
Nach Angaben der Senatorin gibt es in Bremen 8500 Hektar landwirtschaftliche Fläche, davon sind 80 Prozent Grünland. Davon wiederum liegt ein Großteil auf Niedermoor. Um die Moorflächen nutzbar zu machen, wird der Wasserstand seit Jahrhunderten künstlich niedrig gehalten. In den trockengefallenen Mooren zersetzen sich allerdings organische Substanzen, in der Folge werden große Mengen Treibhausgase freigesetzt. Diese beschleunigen bekanntlich die globale Erderwärmung und den Klimawandel. Nach Angaben des Nabu werden bundesweit jährlich etwa 44 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente aus entwässerten Moorböden freigesetzt. Das entspreche rund fünf Prozent der Gesamtemissionen der Bundesrepublik Deutschland. In Bremen wird deshalb in verschiedenen Projekten getestet, wie sich die Bewässerung von Moorböden vor allem im Blockland und in Oberneuland auswirkt. Einige Landwirte haben jedoch Bedenken, dass sie die vernässten Grünflächen nicht mehr bewirtschaften können und das ihre Existenz gefährdet.
Was wird im Rahmen von Green Moor II untersucht?
Die Messungen sollen zeigen, ob sich der Ausstoß von Treibhausgasen in Abhängigkeit vom Wasserstand unter der Erde verändert. Untersucht wird nach Angaben von Projektleiter Heiko Gerken auch, welche Auswirkungen das Düngen hat. Als Versuchsflächen stehen den Mitarbeitern des Grünlandzentrums Niedersachsen/Bremen zwei jeweils 20 Hektar große Flächen im Blockland zur Verfügung. In Abstimmung mit den Landwirten wollen die Forscher drei Jahre von April bis Oktober einmal wöchentlich an verschiedenen Messpunkten den Ausstoß von Treibhausgasen messen. Das Projekt ist auf insgesamt vier Jahre angelegt, die Kosten in Höhe von knapp 800.000 Euro übernimmt das Bremer Landesumweltressort. "Green Moor I" ist vor einem Jahr in Niedersachsen gestartet.
Warum ist das Projekt so besonders?
Green Moor II sei das erste und bislang einzige Bremer Forschungsprojekt zum Thema Treibhausgase und Bewirtschaftung auf Moorflächen, heißt es im Umweltressort. Wissenschaftler der Universität Greifswald begleiten das Projekt und werten die Daten aus. Ein interdisziplinär besetzter Beirat mit Fachleuten aus Klimaschutz, Naturschutz, Landwirtschaft und Wasserwirtschaft unterstützt die Umsetzung. Ziel ist es, falls nennenswerte Emissionen von Treibhausgasen festgestellt werden, diese durch eine "moderate Anhebung der Wasserstände zu reduzieren", so eine Sprecherin des Umweltressorts. Gleichzeitig sollen "praxistaugliche Bewirtschaftungsmethoden" entwickelt werden, die neben dem Klimaschutz auch die landwirtschaftliche Wertschöpfung sicherstellen. "Die Landwirte sind auch unsere Partner, wenn es darum geht, mehr Umwelt- und Klimaschutz zu betreiben", betonte Senatorin Kathrin Moosdorf.
Welche Ergebnisse erhoffen sich die Experten?
"Wir wollen Fakten", erklärte der Geschäftsführer des Grünlandzentrums Niedersachsen/Bremen, Arno Krause. Darauf aufbauend könne man ein differenziertes Wassermengen-Management entwerfen. Es gelte die Marke zu finden, bis zu der man die Böden entwässern muss, damit die Landwirte noch auf ihnen wirtschaften können.
Was sagen die Landwirte?
Hilmar Garbade, Präsident des Bremischen Landwirtschaftsverbandes, sieht in dem Projekt eine Chance, die Ängste einiger Landwirte zu zerstreuen: "Wir sind dankbar, dass hier ergebnisoffen geguckt wird", ob und wo eine Vernässung der Grünflächen tatsächlich sinnvoll sei. Mit wissenschaftlichen Daten belegte, belastbare Ergebnisse zu haben, sei in diesem Zusammenhang wichtig. Über die Ergebnisse von Green Moor II müsse man nach der Auswertung diskutieren. Der Präsident der Bremer Landwirtschaftskammer, Ralf Hagens, sagte: "Ziel muss es sein, dass die Betriebe zukunftssicher wirtschaften können."
Warum stellt Henner Bavendamm sein Grünland zur Verfügung?
"Wir sind Teil der Lösung", sagt der 52-jährige Landwirt. Henner Bavendam hält im Blockland 100 Milchkühe und bewirtschaftet 120 Hektar Grünland. "Wir müssen die Grundlage unserer Bewirtschaftung kennen, damit wir etwas verändern können", sagt er. Vom Projekt Green Moor II erhofft er sich Hinweise, welchen Beitrag er leisten kann. Sein Ziel sei es, CO2 einzusparen, denn der Klimawandel mache ihm auch als Landwirt zu schaffen. Bislang habe der lehmhaltige Boden im Blockland dafür gesorgt, dass er seine Flächen auch in trockenen Phasen über lange Zeit bewirtschaften konnte. Darauf kann sich Bavendam nicht mehr verlassen: "2018 habe ich nicht gewusst, wie ich die Kühe sattkriege." Im Winter 2023/2024 dagegen habe er Sandsäcke gefüllt, um sein Hab und Gut vor Hochwasser zu schützen. "Wir müssen sehen, dass wir eine Lösung finden", so Bavendam. Er sei "fest überzeugt davon, dass wir wirtschaften und gleichzeitig CO2 einsparen können".