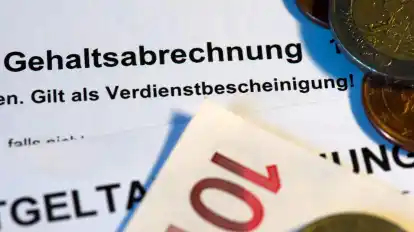Frau Vogt, das Wirtschafts- und Arbeitsressort will geflüchteten Menschen aus der Ukraine den Weg in den Arbeitsmarkt ebnen. Über wie viele Menschen reden wir da eigentlich?
Kristina Vogt: Aktuell sind etwa 7500 Geflüchtete aus der Ukraine in Bremen, der größte Teil Frauen und Kinder. Das zeigt schon, dass es anders ist als 2015/16. Damals hatten wir viele junge Männer hier; Familien, die noch in Zeltlagern waren, hatten die Reisefähigsten vorgeschickt. Jetzt sind die Familien mit Kindern zuerst da. Kinder müssen betreut und untergebracht werden, wir brauchen zusätzliche Kita- und Schulplätze. Erst dann können die Frauen eine Arbeit aufnehmen. Bisher haben sich ungefähr 60 Frauen bei der Agentur für Arbeit gemeldet.
Das sind ja vergleichsweise wenige.
Ich finde es richtig, den Leuten erst einmal Ruhe und Schutz zu geben, sie kommen aus dem Bombenhagel. Ich war ein bisschen sauer, dass sich einige Branchen unmittelbar nach Kriegsbeginn hingestellt und gesagt haben: Prima, jetzt haben wir unser Fachkräfteproblem gelöst. Das fand nicht nur ich unmoralisch, die Menschen hatten zu dem Zeitpunkt andere Sorgen. Übrigens waren das oft Branchen, die eine geringe Tarifbindung haben oder schlechte Löhne zahlen. Auch hier in Bremen hat ein Gastronomieverband sofort gesagt: Wir können bis zu 1000 Leute nehmen. Zu Beginn war es außerdem so, dass viele Geflüchtete dachten, dass sie schnell wieder zurückkönnen. Ich gehe davon aus, dass wir in den kommenden Monaten zunehmend Menschen aus der Ukraine haben, die hier arbeiten wollen. Unsere Erfahrung ist, dass besonders Frauen mit Kindern nicht vom Staat abhängig sein wollen.
Die meisten der Geflüchteten waren in der Ukraine erwerbstätig oder in Ausbildung, das ist eine günstige Ausgangssituation, oder?
Die Situation jetzt ist aus unterschiedlichen Gründen nicht vergleichbar mit 2014, 2015 oder 2016, als viele junge Männer kamen, die teilweise wegen der Flucht jahrelang keine Schule besucht haben. Die Menschen aus der Ukraine kommen in der Regel aus der Berufstätigkeit. Deswegen ist die Frage nach der Anerkennung von beruflichen Abschlüssen jetzt noch dringender zu lösen als damals. Die Hochschulabschlüsse sind mit unseren vergleichbar, für die duale Ausbildung muss jetzt schnell eine unbürokratische Lösung gefunden werden. So entsteht die Möglichkeit, diejenigen, die arbeiten wollen, ihrer beruflichen Qualifikation entsprechend einzustellen. Wir wollen ja auch, dass die Menschen hier zu guten Löhnen arbeiten und Dumpinglöhne verhindern.
Das Ziel ist also, Geflüchtete in der Branche unterzubringen, in der sie vorher tätig waren? Bremen fehlen ja durchaus Fachkräfte in bestimmten Bereichen.
Generell muss man erst einmal sehen, welche Qualifikationen die Menschen mitbringen, und ob diese hier gebraucht werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das wie bei jedem Arbeitnehmer, jeder Arbeitnehmerin sonst auch: Wir bemühen uns, die Menschen in Qualifizierungsmaßnahmen zu bekommen. Da versuchen wir schon, passgenau Programme aufzulegen, zum Beispiel "Frauen in IT" oder der Quereinstieg in den Erzieherinnenberuf über "Perspektive Arbeit für Frauen". Vorgelagert ist aber der Spracherwerb, der muss im Vordergrund stehen.
Wie wird der gefördert?
Wir haben verschiedene Programme mit insgesamt 150 Millionen Euro aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes für die Förderperiode 2021 bis 2027. Es gibt die Koordinierungsstelle Sprache des Landes Bremen, Träger ist das Zentrum für Schule und Beruf des Deutschen Roten Kreuzes. Dort lernen Menschen, die hierherkommen, die deutsche Sprache. Dann haben wir die Bremer Integrationsqualifizierung (BIQ) mit denselben Trägern. Dort geht es darum, das Sprachniveau zu erreichen, das man braucht, um in eine Einstiegsqualifizierung oder eine Ausbildung zu gehen, also B1. Die BIQ ist übrigens auch von der EU-Kommission als ein Best-Practice-Beispiel als spezielles Angebot für Menschen mit Fluchterfahrung ausgewählt worden.
Was bereitet Ihr Ressort speziell für die ukrainischen Geflüchteten vor?
Erst einmal erweitern wir die Gruppe der Sprach- und Kulturmittler (Sprinter). Da haben wir bisher von insgesamt 60 Personen nur wenige, die aus der Ukraine oder Russland kommen. Dieses Projekt haben wir um 20 Stellen aufgestockt, mit Schwerpunkt auf Ukrainisch und Russisch. Bei der Performa Nord werden wir für den öffentlichen Dienst auch einen Sprach- und Kulturmittlerpool aufbauen, mit weiteren 20 Stellen. Außerdem haben wir Modellprojekte, die wir 2018/19 für Menschen mit Migrationshintergrund in Quartieren aufgesetzt haben, pauschal um ein Jahr verlängert. Die Frauenberatungsstellen in Bremen und Bremerhaven sind auch für ukrainische Frauen da. Ein ganz wichtiger Punkt ist zudem, die Menschen über ihre Möglichkeiten und Rechte zu informieren und vor Arbeitsausbeutung zu schützen. Der Beratungsstelle Moba für mobile Beschäftigte aus dem Ausland haben wir den Auftrag gegeben, sich auch als Anlaufstelle für die ukrainischen Geflüchteten zur Verfügung zu halten. Wir müssen jetzt nicht aktionistisch neue Projekte aus dem Boden stampfen, weil wir unsere Programme ergänzend zu dem, was der Bund macht, bereits haben. Das kann sich ändern, wir überprüfen deshalb laufend, ob die Angebote passend sind. In einer ersten Analyse haben wir keine große Förderlücke entdeckt – es sei denn, wir könnten Kitas und Schulen aus dem Hut zaubern.
Und in Zahlen: Wie viel Geld setzt das Ressort zusätzlich für die ukrainischen Geflüchteten ein?
Zurzeit eine Million Euro, schätze ich. Das liegt auch daran, dass während der Ankommens- und Registrierungsphase erst einmal andere Senatsressorts zuständig sind. Alles, was wir derzeit zusätzlich einsetzen, ist mit Blick nach vorn. Im Wesentlichen sieht es auch so aus, dass die Zusagen des Bundes, die Sprachförderung ausreichend zu finanzieren, funktionieren. Wir müssen dann noch einmal sehen, ob wir bei der Kinderbetreuung beteiligt werden sollen. Der Senat hat das Signal gegeben, dass es am Geld nicht scheitern soll, so würden Spielräume möglich sein.