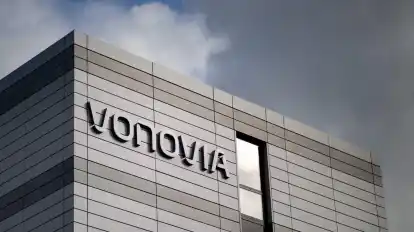Eine Wohnung zu mieten, könnte in einigen Jahren so bequem sein, wie ein Fahrrad zu leihen oder Carsharing-Angebote zu nutzen. Nach dem Motto "Eintreten und loswohnen" lädt der künftige Mieter zunächst eine App herunter, meldet sich an und sucht sich in seinem bevorzugten Quartier eine freie Wohnung, die er zur Besichtigung schlüssellos betritt. Bei Gefallen bestätigt er mit dem „Miet-mich“-Button und schließt den digitalen Mietvertrag ab. Smartphone oder Tablet loggen sich in das Smart-Living-System der Wohnung ein und steuern Jalousien, Wärme- und Soundsystem.
So stellen sich die Autoren des Branchenberichts Wohntrends 2040 die Zukunft vor. Alle fünf Jahre lässt die Wohnungswirtschaft Deutschland GdW, zu der 3000 Wohnungsunternehmen mit sechs Millionen Wohnungen und 13 Millionen Mietern gehören, die Wohntrends der Zukunft ermitteln. Mehr als 2000 Mieter sind dafür befragt worden.
Manches klingt heute noch wie Science Fiction, andere Trends sind nicht neu, entwickeln aktuell aber eine ungekannte Dynamik. Der WESER-KURIER hat aus dem 120-seitigen Bericht einige Thesen formuliert, die beschreiben sollen, wie wir 2040 leben.
Weniger ist mehr beim Lebensstil
Mehr als 10.000 Gegenstände soll ein deutscher Haushalt im Durchschnitt besitzen. Wie viele davon sie tatsächlich benötigen, fragen sich immer mehr Menschen. Besitz kann belasten, deshalb verordnen sich immer mehr Menschen einen bescheideneren Lebensstil. Bis zu 30 Prozent der Gesellschaft sind für eine minimalistische Lebensweise offen, schätzt Bettina Harms, Geschäftsführerin der Beratungsgesellschaft Analyse und Konzept, die an den Wohntrends 2040 mitgearbeitet hat.
Der neue Minimalismus wird sich künftig im Einrichtungsstil der Häuser und Wohnungen niederschlagen. Schrankraum wird reduziert, weil es nur wenig Kleidung und andere Gegenstände gibt. Möbel werden weniger und multifunktional genutzt: Der Schreibtisch ist auch Esstisch. Das Bett ist tagsüber Sofa. Küchen sind auf ihre Basisfunktion – das Kochen – reduziert. Es gibt nur wenige Accessoires, das Tablet ersetzt Fernsehgerät und Stereoanlage. Und statt eines eigenen Pkw nutzen diese Haushalte Sharing-Angebote und den Öffentlichen Personennahverkehr, der sich durch eine hohe Taktung, günstige Tickets und Haltestellen vor der Haustür auszeichnen muss.

Minimalismus als Lebensstil: Wohnen auf kleiner Fläche beziehungsweise ohne unnötige Accessoires ist ein Trend, der sich nach Einschätzung der Experten noch verstärken wird.
Die Generation Greta setzt neue Prioritäten
Greta Thunberg war 15, als sie zum Gesicht einer Generation wurde, die 2018 auf die Straße ging, um für mehr Klimaschutz zu kämpfen. Der Soziologe Klaus Hurrelmann spricht bei Fridays for Future von der kraftvollsten Bewegung seit den 68-ern. „Die junge Generation nimmt unmittelbar Einfluss auf ihr Elternhaus“, heißt es in der Studie. „Nachhaltige Lebensweisen bekommen einen immer höheren Stellenwert“, sagt Michael Neitzel vom Institut für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung.
Daraus müssten Wohnungsunternehmen Schlüsse ziehen und künftig zum Beispiel stärker auf den Einsatz von nachhaltigen Materialien setzen, den Flächenverbrauch reduzieren und die Biodiversität erhalten. Lebenswert, gut durchgrünt und vielfach naturbelassen soll das Wohnumfeld aus Sicht der Generation Greta sein. Grüne Dächer und Fassaden werden die Regel. Je nach Bauart können sie 70 bis 90 Prozent des Niederschlagswassers zurückhalten. Die Bedeutung von Nachhaltigkeitsthemen, so die Studienautoren, zeige sich schon jetzt am Verhalten von Investoren und Kapitalanlegern, die nachhaltigen Investitionen vermehrt den Vorzug gäben.
Die zentral gelegene Kleinstadt wird immer attraktiver
Wo wollen die Menschen am liebsten leben: in der Stadt oder auf dem Land? Antwort: immer häufiger dazwischen, in der zentral gelegenen Kleinstadt. Großstädte üben nach wie vor eine hohe Anziehungskraft auf die Menschen aus, aber der Anteil derer, die zentrumsnah wohnen möchten, ist innerhalb von vier Jahren von 33 Prozent auf 23 Prozent gesunken.
Die Gründe dafür sind vielfältig: Die Mieten in der Innenstadt steigen. Zwar tun sie das in den Speckgürteln und Umlandgemeinden auch, teilweise sogar noch stärker, aber dafür punkten Kleinstädte mit anderen Vorzügen, die vor allem während der Corona-Pandemie tiefer ins Bewusstsein gedrungen sind. „Die Sehnsucht nach privaten Grün- und Freiflächen, die während des Lockdowns aufgekommen ist, führt zu Wanderungsgewinnen weniger dicht besiedelter Räume“, heißt es in der Studie.
Die Wohnung wird zum Arbeitsort
37 Prozent der Befragten haben während der Pandemie und ihrer Zeit im Homeoffice festgestellt, dass sich ihre Anforderungen an die eigene Wohnung geändert haben. Sie benötigen ein zusätzliches Arbeitszimmer, eine andere Raumaufteilung oder schlicht mehr Platz. „Home bleibt Office“, das hat die Beratungsgesellschaft pwc ermittelt, an zwei oder drei Tagen in der Woche würden Arbeitnehmer auch künftig gern von zu Hause aus arbeiten.
„Das wird unsere Quartiere nachhaltig wandeln“, sagt Neitzel. Gemeinschaftliche Räume wie Coworking-Spaces und Werkstätten würden an Bedeutung gewinnen. Fünf Prozent der Befragten nutzen bereits Angebote zum gemeinschaftlichen Arbeiten, das Interesse an solchen Anlaufpunkten im Quartier sei sechs Mal so hoch. Das biete auch dem ländlichen Raum eine Chance, wenn er verstärkt auf Co-Working-Angebote setze.
Die Wohn- und Energiekosten werden zur Herausforderung
Massiv steigende Energiekosten und Mieten, eine Inflationsrate auf Rekordniveau und sinkende Reallöhne sorgen dafür, dass Wohnen immer teurer wird. Der Anteil der Gesamtmiete am Nettoeinkommen, das den Haushalten zur Verfügung steht, ist laut Wohnstudie innerhalb von vier Jahren von 31,5 auf 33 Prozent gewachsen, bei Haushalten mit geringen Einkommen sogar auf 37 Prozent.
Daraus ergeben sich zwei Konsequenzen. Erstens: Eine deutlich größere Gruppe an Mietern ist heute – notgedrungen – bereit, auf höhere Ausstattungsstandards zugunsten geringerer Wohnkosten zu verzichten. Zweitens: „Wir brauchen günstigere Energiequellen und müssen die Verbräuche reduzieren“, sagt Harms, die Mieter und Vermieter in der Pflicht sieht, „30 Prozent des Verbrauchs ist verhaltensabhängig.“
Das Bewusstsein dafür scheint bei den Mietern vorhanden zu sein. Über 80 Prozent geben in der Befragung an, bewusster oder weniger zu heizen, wenn sie über ihren monatlichen Energieverbrauch informiert würden. Helfen könnte hierbei eine entsprechende Mieter-App. Auch das Interesse an Balkonkraftwerken und Mieterstrom, der aus Fotovoltaikanlagen auf den Dächern der Umgebung gewonnen wird, sei grundsätzlich vorhanden, heißt es. Die Vermieter ihrerseits müssten für passende Heizsysteme und wärmegedämmte Wohnungen sorgen. Fazit der Studie: „Der Trend zum Energiesparen wird sich über das Jahr 2040 hinweg weiter fortsetzen.“
Die Kinder von heute sind die Mieter von morgen
Rund elf Millionen Kinder unter 14 Jahren leben in Deutschland. Das sind zwölf Prozent der Bevölkerung und damit eine Minderheit. Mehr als 40 Prozent der unter Fünfjährigen hatte 2020 einen Migrationshintergrund. „Ihre Interessen und Bedürfnisse fallen oft zu wenig ins Gewicht“, heißt es in der Wohnstudie. „Wie Kinder heute aufwachsen, wird bedeutend für die Gesellschaft der Zukunft sein. Diese Erfahrungen werden ihre Vorstellung vom Wohnen und vom Miteinander in Nachbarschaften prägen.“ Im Jahr 2040 haben die heute unter Zwölfjährigen bereits ihre erste eigene Wohnung bezogen und sind selbst dabei, Familien zu gründen.
Eine aktuelle Beobachtung: „Besonders Familien sind mit ihrer Wohnsituation unzufrieden“, sagt Harms. Sie störten sich vor allem an der Wohnungsgröße und an den Kosten. Ihr Nachteil auf dem Markt: Familien mit Kindern zögen im Wettbewerb mit anderen Teilnehmern oft den Kürzeren. Die Studienautoren leiten daraus einen Auftrag an die Wohnungsunternehmen ab: Sie sollten Familien bei der Wohnungsvergabe bevorzugen. Familien hätten vor allem einen Vorteil: Sie können starke Netzwerke im Quartier bilden und damit die Grundlage für eine lebendige und generationenübergreifende Nachbarschaft legen.
Das Quartier kann ein Dorf sein
2040 werden etwa 23,2 Millionen Menschen in Deutschland leben, die älter als 65 Jahre sind. Das sind fast fünf Millionen mehr als heute. Die meisten älteren Menschen wollen solange wie möglich in ihrem vertrauten Wohnumfeld bleiben. Das wird die Wohnungswirtschaft dazu zwingen, noch stärker als bisher altersgerechte Wohnformen anzubieten, Barrieren zu reduzieren und kombinierte Wohn- und Pflegemodelle zu entwickeln.
Mehr als ein Viertel der für die Wohntrendstudie befragten Menschen hat angegeben, keine oder nur begrenzt Menschen zu haben, die ihnen nahestehen. Das stellt die Gesellschaft vor Herausforderungen, denn einsame Menschen werden häufiger krank und erleben stärkeren Stress. Quartiere und Nachbarschaften gelten als ein Ort, um die Einsamkeit zu überwinden. Das sei allerdings an Voraussetzungen geknüpft, heißt es in der Studie. Nur rund 30 Prozent der Nachbarn sind untereinander digital vernetzt, deshalb müssten Quartiersmanager moderieren, unterstützen und ansprechen. Offene Eltern-Kind-Tage, Kennenlerntreffs, Lese-, Spiel- und Handarbeitsnachmittage oder Spaziergangscafés hätten besonders in immer digitaler werdenden Zeiten eine große Bedeutung. „Das Quartier kann ein Dorf sein“, heißt es. Insektenwiese, Hochbeet und Bolzplatz sind die Orte, an denen das im Freien gelebt werden soll.