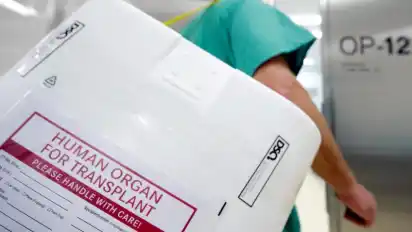Martina und Jochen Osmers blinzeln in die Sonne. Der Frühling lässt sich an Tagen wie diesen schon erahnen. Für das Ehepaar ist dieses Jahr ein ganz besonderes. "Im Grunde ein neues Leben, auf das wir uns freuen", sagt Jochen Osmers. Fast auf den Tag genau vor drei Monaten hat der 61-Jährige eine neue Niere bekommen. Spenderin ist seine Frau.
Jochen Osmers leidet an einer erblich bedingten Krankheit, wodurch die Nieren nach und nach ihre Funktion verlieren. Medikamente oder Behandlungen, die den Zerstörungsprozess aufhalten oder heilen könnten, gibt es nicht. Der 61-Jährige weiß, was das bedeutet. Auch seine Mutter ist daran erkrankt, seit 15 Jahren muss sie zur Dialyse. Seine Mutter komme gut damit zurecht, "jahrelang mehrere Male in der Woche zur Dialyse zu müssen, war für mich eine schwierige und belastende Perspektive", sagt er rückblickend.
Die Alternative: eine Organtransplantation. Allerdings: Die Wartezeit für eine Spenderniere liegt in Deutschland bei acht bis zehn Jahren. Es gibt nicht genug Menschen, die verfügt haben, dass ihre Organe – Herz, Nieren, Lunge und andere Organe sowie Gewebe – schwerkranken Menschen nach dem eigenen Tod das Leben retten sollen. "Wir haben sehr früh mit der Ärztin über das Thema Organspende gesprochen, auch über eine Lebendspende als Option", sagt der 61-Jährige. Als sich die Nierenwerte von Jochen Osmers immer weiter verschlechtern, rückt diese Möglichkeit in den Fokus.
Bevor eine Lebendspende überhaupt infrage kommt, muss der potenzielle Spender oder die Spenderin umfassend medizinisch untersucht werden. Um zu klären, ob etwa die Gewebemerkmale zueinander passen und ob eine Organentnahme aus medizinischer Sicht überhaupt zu verantworten ist. Denn: Der Spender oder die Spenderin hat dann nur noch eine Niere. Eine Lebendspende ist zudem nur zulässig, wenn sich Spender und Empfänger nahestehen. Bei Verwandten ersten oder zweiten Grades, Verlobten, Lebenspartnerinnen und -partnern oder Personen, die sich in persönlicher Verbundenheit nahe sind, ist das etwa der Fall. Finanzielle Erwägungen dürfen keine Rolle spielen.
Martina Osmers ist die perfekte Spenderin, wie die medizinischen Untersuchungen zeigen. "Wir haben die gleiche Blutgruppe, eine seltene noch dazu, alle anderen Merkmale passten, wir sind verheiratet. Es stimmte einfach alles", sagt sie. "Ich hatte den Tüv meines Lebens, bin kerngesund." Als das feststeht, bleibt die Frage: Ist sie bereit, sich eine gesunde Niere entfernen zu lassen? "Die Entscheidung ist mir leicht gefallen", sagt die 53-Jährige. "Wir sind beide positive Menschen. Es ist ein Geschenk, dies machen zu dürfen und die Chance zu haben, ein entspannteres Leben führen zu können; dass mein Mann gesund wird. Manchmal muss man eine Chance einfach ergreifen. Das war für mich alternativlos."
Am frühen Morgen des 8. Dezember liegt das Ehepaar nebeneinander im OP des Transplantationszentrums im Klinikum Bremen-Mitte. Jochen Osmers ist bereits seit Mitte November in der Klinik, eine der beiden kranken Nieren wurde entfernt. Eine Besonderheit der Nierentransplantation ist, dass die kranken Nieren des Empfängers im Körper belassen werden. Bei Jochen Osmers war das nicht möglich: Die Niere, die entfernt wurde, war extrem vergrößert und drückte auf die anderen Organe. Martina Osmers kommt als Erste aus dem OP. Als sie später aufwacht, wird ihr Mann ins Zimmer gebracht. Alles sei gut gelaufen, sagen ihr die Ärzte. Eine ihrer Nieren gehört jetzt zu ihm.
Lebendspenden sind keine Ausnahme. Prominentes Beispiel ist Elke Büdenbender, die von ihrem Mann, dem heutigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, eine Niere bekam. "Der Anteil bewegt sich zwischen zehn und 20 Prozent an den Transplantationen. Je geringer die Organspendezahlen sind, desto eher rückt die Lebendspende in den Fokus", sagt Sebastian Melchior, Direktor des Transplantationszentrums im Klinikum Mitte. Das Bremer Zentrum ist wichtiger Standort für Nierentransplantationen im Nordwesten, 1108 Nieren wurden seit 1988 dort transplantiert.
Aus medizinischer Sicht sind Lebendspenden laut Melchior eine sehr gute Option. Das Organ kommt von einem gesunden Spender, der Zeitpunkt kann gewählt werden, der Empfänger muss nicht viele Jahre warten, in denen sich der Zustand noch weiter verschlechtert. "Es ist aber auch eine Organentnahme bei einem gesunden Menschen. Wie jede OP birgt das Risiken, dazu kommt, dass der Spender nur noch eine Niere hat und theoretisch auch selbst erkranken kann. Das ist so", betont der Arzt.
Die Transplantationszahlen hätten sich in den vergangenen Jahren nicht wesentlich verändert – und damit die Lage für die schwerkranken Menschen nicht verbessert. "Absoluter Tiefstand war 2017, danach haben sie sich leicht erholt. Mit der Pandemie in 2020 sind sie eingebrochen", sagt Melchior. Im ersten Pandemiejahr gab es in dem Bremer Zentrum zwölf Nierentransplantationen, 2021 waren es 23, fünf davon Lebendspenden. In diesem Jahr wurde fünfmal transplantiert, zweimal mit Lebendspenden. "Aus meiner Sicht haben die Regelungen, mit denen die Organspendebereitschaft gefördert werden soll, nichts gebracht", kritisiert der Bremer Chefarzt. In Deutschland dürfen Organe und Gewebe nur dann nach dem Tod entnommen werden, wenn die gestorbene Person dem zu Lebzeiten zugestimmt hat. Liegt keine Entscheidung vor, werden die Angehörigen gefragt.
Jochen Osmers geht es drei Monate nach der Transplantation gut. "Es wird immer besser, eigentlich vom ersten Tag an", sagt 61-Jährige. "Wir sind froh, dass wir diese Chance bekommen haben", betont Martina Osmers.