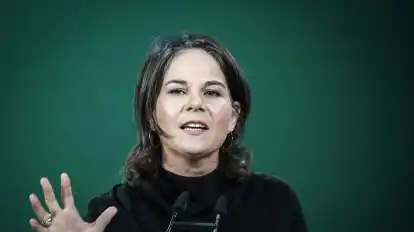Herr Dreeke, vor dem Besuch von Bundeskanzler Scholz in China hat die geplante Beteiligung der chinesischen Staatsreederei Cosco an einem Hamburger Containerterminal für große Diskussionen gesorgt. Sie selbst sehen darin „keinerlei Risiken“. Warum nicht?
Weil es nicht um eine Beteiligung an einem Hafen insgesamt geht, sondern um eine einzelne Anlage. Man muss hier wirklich genau unterscheiden: Der Hafen gehört dem Land Hamburg, die Wasserstraße dem Bund. Die Reederei beteiligt sich an Containerbrücken, an vorhandenen Geräten und an einem Stück befestigter Fläche. Das bringen leider viele Politiker durcheinander.
Das schätzen aber sechs Bundesministerien, die an dem Genehmigungsverfahren beteiligt waren, ganz anders ein: Wirtschafts-, Innen-, Verteidigungs-, Verkehrs- und Finanzministerium sowie das Auswärtige Amt.
Dann schätzen diese sechs Ministerien das falsch ein. Wenn sie sich mit Experten unterhalten würden, die die Hafenwirtschaft und solche Formen von Beteiligung kennen, dann würden sie wahrscheinlich ihre Meinung revidieren. Solche Gespräche bieten wir als Zentralverband der Deutschen Seehafenbetriebe auch an.
Hat denn mal einer bei Ihnen nachgefragt, aus dem Bundeswirtschaftsministerium zum Beispiel?
Nein, niemand. Aber es handelt sich meiner Meinung nach auch ganz klar um eine politisch geführte Diskussion. Das ist es auch, was mich verärgert. Ich wünschte mir, dass die Frage, wie die Wettbewerbsfähigkeit unserer Seehäfen gestärkt und unterstützt werden kann, ebenso intensiv diskutiert würde.
Was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile einer chinesischen Beteiligung an einem Hamburger Hafentermimal?
Beteiligungen eines Reeders an einem Terminal bedeuten immer, dass der Reeder sich an diesen Hafen bindet. Das schafft Umschlagsvolumen, was wiederum Arbeitsplätze sichert. Wenn ein Unternehmen mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt eine solche Beteiligung vereinbart, ist das gut für uns. In Krisenzeiten kann man davon nur profitieren.
BLG und Eurogate haben mit solchen Reedereibeteiligungen in Bremerhaven gute Erfahrungen gemacht – im Containerumschlag, jetzt auch im Automobilbereich.
Absolut.
Nun ist aber Cosco kein rein kommerzielles Unternehmen wie Maersk, MSC oder Hyundai, sondern eine Staatsreederei, die von sich selbst sagt: „Wir folgen den Anweisungen der Partei und segeln fürs Vaterland.“ Und „die Partei“ und „das Vaterland“ – das ist eine totalitäre Ein-Parteien-Diktatur mit Großmachtambitionen, die Nachbarländer ganz offen militärisch bedroht. Muss man das nicht in der Diskussion berücksichtigen?
Ja und nein. Handel mit China zu betreiben, ist eine grundsätzliche Entscheidung, die die Bundesrepublik schon vor Jahrzehnten gefällt hat. Wir müssen sicherlich darauf achten, dabei beidseitig eine gewisse Fairness walten zu lassen. Aber man hat immer gewusst, mit welchem politischen Regime man Geschäfte macht. Und egal ob es die Automobilindustrie ist, die Maschinenbauindustrie oder die chemische Industrie: China ist mittlerweile einer der wichtigsten Handelspartner.
Aber China verändert sich: Man dachte, das sei ein Wirtschaftswunderland, das sich langsam auch politisch öffnet. In den letzten zehn Jahren hat sich das aber in die andere Richtung entwickelt – zurück in eine Diktatur, die mit ihrem totalitären Politikmodell eine Weltmacht werden will.
Meine Hoffnungen waren das nie. Und ich glaube nicht, dass sich die wirtschaftlichen Entwicklungen in China in den letzten zehn, fünfzehn Jahren so stark gewandelt haben. Was sich gewandelt hat, ist der chinesische Anspruch, auch außerhalb des eigenen Landes wirtschaftlich aktiv zu werden – Stichwort "Neue Seidenstraße". Wir täten gut daran, darauf eine Antwort zu finden – wir als Europäer.
Mit dem "Seidenstraßen"-Projekt will China wirtschaftliche Abhängigkeiten schaffen, die man dann politisch ausnutzen kann.
Das haben sie in einigen Ländern auch schon geschafft.
Sogar in Europa: Der Hafen von Piräus gehört mittlerweile mehrheitlich Cosco. Und bei einer Abstimmung im Menschenrechtsrat der Uno blockiert Griechenland prompt eine gemeinsame Erklärung der EU-Staaten, mit der die Menschenrechtssituation in China verurteilt werden sollte. Ist das nicht schon politische Einflussnahme?
Der Riesenunterschied ist, dass Piräus den gesamten Hafen an die Chinesen verkauft hat, nicht nur eine Minderheitsbeteiligung von 24,9 Prozent an einem kleinen Containerterminal.
Das ist ja jetzt die Kompromisslinie der Bundesregierung für die Beteiligung in Hamburg: 24,9 Prozent statt 35 Prozent. Was ist der Unterschied?
Bei einer GmbH liegt die Sperrminorität, mit der man unternehmerische Entscheidungen beeinflussen kann, bei über 25 Prozent vor. 24,9 Prozent wären also eine reine Finanzbeteiligung.
Müssten solche Geschäfte nicht auf Gegenseitigkeit beruhen? Die Chinesen lassen keine Beteiligungen an ihren Terminals zu.
Ich kann Ihnen gar nicht sagen, ob das wirklich so ist, wir haben es jedenfalls noch nicht probiert. In der Automobil- oder Maschinenbauindustrie gibt es solche Joint Ventures jedenfalls schon seit vielen Jahren.
Wie geht es weiter mit dem Welthandel in einer Welt, die wieder in Blöcke zerfällt?
Ich glaube nicht, dass wir den Verfall der Globalisierung erleben werden. Wir werden weiter in einer globalisierten Welt leben. Wir werden allerdings aufgrund der Krisen, die wir durchleben, darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, bestimmte Waren im überseeischen Ausland zu produzieren oder wieder stärker in Europa anzusiedeln.
Heißt das dann auch: Es gibt weniger zu transportieren?
Die Transportwege würden sich ändern, aber nicht die Menge der Transporte. Vielleicht spielt dann die Bahn eine größere Rolle oder das Binnenschiff. Oder Feederverkehre, also Kurzstreckenverkehre entlang der Küste.
Und was bedeutet das für ein Logistikunternehmen wie die BLG? Könnten Sie sich dem anpassen?
Absolut. Dafür haben wir Anlagen in den Häfen, aber auch im Binnenland, die so etwas können. Ein Logistikunternehmen zeichnet sich durch schnelle Anpassungsfähigkeit aus. Und ich denke, die können wir vorweisen.
Das Gespräch führte Christoph Barth.