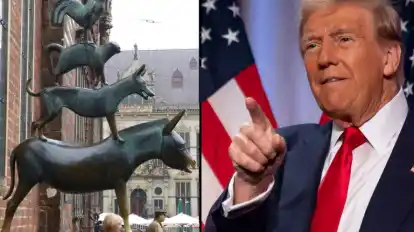Herr Spinn, lassen Sie uns mit guten Nachrichten starten. Wie vielen Menschen in Bremen ist vergangenes Jahr vom Jobcenter aus der Wiedereinstieg in Arbeit gelungen?
Thorsten Spinn: Wir zählen fast 9400 Fälle. Das zeigt auch eine gewisse Dynamik: Es gibt keine feste Anzahl an Bürgergeldbeziehenden. Da ist viel Bewegung drin.
Warum klappt der Neustart? Was ist aus Ihrer Sicht entscheidend?
In der Regel fällt der Wiedereinstieg den Menschen leichter, die gerade erst ihren Job verloren haben. Ihre Qualifikationen sind noch auf dem aktuellen Stand. Das ist für Arbeitgeber natürlich interessanter. Wir haben leider die Situation, dass etwa zwei Drittel unserer Kundinnen und Kunden keinen Berufsabschluss hat. Einer unserer Schwerpunkte ist darum immer, die Menschen weiter zu qualifizieren. Das ist das A und O.
Wie hat sich die Zahl der Langzeitarbeitslosen in Bremen entwickelt?
Im Dezember waren es genau 12.679 Menschen. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr – 614 Menschen mehr.
Woran liegt das? Haben Sie eine Erklärung?
Es ist vielschichtig. Ich glaube, es macht sich bemerkbar, dass wir seit zwei Jahren in der Rezession sind. Der Arbeitsmarkt ist insgesamt angespannt. Es gibt Unternehmen, die in Teilen ihre Fachkräfte freisetzen. Dadurch entsteht ein gewisser Verdrängungseffekt. Insofern ist die Arbeitsplatzsuche für unsere Kundinnen und Kunden schwieriger geworden.
Viele Jahre brummte die Wirtschaft. Jetzt fehlt das Wachstum. Es droht in einigen Konzernen ein massiver Stellenabbau. VW ist nur ein Beispiel. Macht Ihnen diese Kulisse Sorge? Könnte das Problem von Massenarbeitslosigkeit zurückkehren?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Im Moment haben wir natürlich eine Stagnation in der Wirtschaft. Unternehmen stecken mitten in der Transformation. Die Autoindustrie steht insbesondere vor der Herausforderung des Umstiegs auf die E-Mobilität. Zulieferbetriebe müssen sich anpassen. Es verändern sich Wirtschaftszweige ganz extrem. Gleichwohl kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Unternehmen wie VW irgendwann nicht mehr gibt. Wir wünschen uns eine Vorhersage: Wo sind wir in fünf Jahren? Wo sind wir in zehn Jahren? Das fällt aber häufig schwer. In Bremen gibt es etwa für das Stahlwerk sehr konkrete Pläne zur Transformation. Zugleich werden nicht alle Entscheidungen hier getroffen.
Eine gewisse Angst um den Arbeitsplatz ist zurückgekehrt. Zugleich fehlen Arbeitskräfte und Fachkräfte.
Viele Jahre kannten wir die Sorge um den Arbeitsplatz nicht. Im Zweifelsfall gab es gute Alternativen. Das Sicherheitsgefühl ist zumindest angekratzt. Die Bundesagentur für Arbeit nimmt derzeit verstärkt in den Blick, wie Menschen direkt wieder in Beschäftigung kommen können, wo Arbeitskräfte gesucht werden. Das hat an Bedeutung gewonnen.
Um Geflüchtete schneller in Arbeit zu bringen, ist der "Jobturbo" in den Jobcentern gezündet worden. Was beobachten Sie – etwa mit Blick auf die Menschen aus der Ukraine?
Wir stellen bei den Geflüchteten aus der Ukraine eine hohe Motivation fest. Die Menschen wollen gerne arbeiten. In Deutschland haben wir allerdings schon noch einen anderen Arbeitsmarkt: In den allermeisten Betrieben sind Deutschkenntnisse die Voraussetzung, während in Dänemark oder den Niederlanden Englisch funktioniert, was viele Ukrainer sprechen. Die Sprache bleibt also zentral für uns. Es geht auch darum, dass jemand auf lange Sicht einen Arbeitsplatz seiner Qualifizierung entsprechend aufnimmt – und nicht auf dem Status als Helfer bleibt.
Schauen wir aufs Jobcenter selbst. 2024 war turbulent mit einem selbst verschuldeten Finanzchaos. Weil schon mehr Geld verplant war als gedacht, gab es im Sommer einen Förderstopp. Wie blicken Sie zurück?
Es war turbulent. Wir haben den Anspruch an uns nicht erfüllen können. Ich denke, wir waren in der Aufarbeitung sehr effizient. Im September konnten wir das Fördergeschäft wieder normal aufnehmen. Trotzdem: Das hätte nie passieren dürfen.
Am Ende mussten Sie nicht auf Mittel für 2025 vorgreifen – wie die Notlösung erst vorsah.
Genau. Das ist uns unter anderem durch Einsparungen gelungen.
Wie viel Budget steht Ihnen dieses Jahr zur Verfügung?
Wenn wir die Verwaltungskosten abziehen, bleiben uns als sogenannte Eingliederungsmittel etwa 50 Millionen Euro – mehr als 13 Millionen weniger als 2024. Daraus erklärt sich, dass wir etwa bei den Arbeitsgelegenheiten die Teilnehmerzahl reduzieren müssen.
Das Angebot soll Menschen beim Wiedereinstieg ins Berufsleben helfen. Für viele ist der Platz ein Anker im Leben. Wie viele Plätze fallen weg?
Vor einem Jahr gab es 876 Plätze. Im Laufe des Jahres wird die Zahl auf 491 reduziert.
Weil viel weniger Geld da ist.
Genau. Die Problematik trifft alle Jobcenter im Land: Wir können nicht unseren Bedarf anmelden, wie viel Geld wir eigentlich bräuchten, um alle arbeitssuchenden Menschen zu unterstützen. Wir bekommen ein Budget zugewiesen.
Projektträger, die hier Arbeitsgelegenheiten anbieten, sorgen sich um ihre Existenz. Bekommen Sie davon mit?
Ich höre solche Aussagen. Die Grundidee der Eingliederung ist aber, Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen. Wir fördern keine Projekte oder Träger. Wir müssen uns jetzt auf Instrumente fokussieren. Was angesichts der Kürzungen nicht vergessen werden sollte: Wir mussten als Jobcenter schon immer eine Auswahl treffen. Es hat noch nie für alle gereicht. Auch in der Vergangenheit nicht.
Seit der Einführung des Bürgergelds gibt es Diskussionen dazu – auch jetzt im Wahlkampf.
Meine persönliche Meinung ist: Wir hören sehr viele populistische Aussagen. Es gibt Forderungen nach härteren Sanktionen oder geringeren Regelsätzen. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht dazu Entscheidungen getroffen. Das ist ausgeurteilt. Die Parteien wissen das auch. Sicherlich will mancher eine Stimmung aufnehmen. In unserer Wahrnehmung ist es schon so, dass seit Einführung des Bürgergelds die Bereitschaft der Menschen nachgelassen hat, sich an Pflichten zu halten – zum Beispiel an Termine. Das ist leider eine Entwicklung, die wir in der Gesellschaft insgesamt sehen, die auch Ärzte oder Restaurants spüren. Ob das bei uns aufs Bürgergeld zurückzuführen ist? Ob Sanktionen helfen? Das Verfassungsgericht hat festgestellt, dass die Wirksamkeit von Sanktionen nicht nachgewiesen werden kann.
Was wünschen Sie sich von der nächsten Bundesregierung?
Ich wünsche mir eine gewisse Stabilität. In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder Veränderungen umsetzen müssen. Das kostet Energie. Die Jobcenter brauchen außerdem ein auskömmliches Budget. Wir haben jetzt weniger Geld zur Verfügung – gerade wo der Arbeitsmarkt schwächelt.
Das Gespräch führte Lisa Schröder.

In diesem Jahr steht dem Jobcenter deutlich weniger Geld zur Verfügung, um Menschen bei ihrem Weg zur Beschäftigung zu unterstützen. Jobcenterchef Thorsten Spinn sagt aber auch: ”Wir mussten als Jobcenter schon immer eine Auswahl treffen. Es hat noch nie für alle gereicht.”