Die Welt auf einer der größten deutschen Werften im Großschiffbau schien in Ordnung zu sein, das Unternehmen hatte sich in den Jahren zuvor zu einem der weltweit führenden Produktionsstandorte für Containerschiffe entwickelt. „Wer was kann, geht zum Vulkan“. So lautete der Slogan einer Anzeige, die 1972 in den Bremer Nachrichten erschien.
Dass es den Bremer Vulkan irgendwann einmal nicht mehr geben wird, war zu diesem Zeitpunkt unvorstellbar. Doch die Pleite kam: Am kommenden Montag jährt sich zum 25 Mal der Tag, als am 15. August 1997 in Vegesack die Arbeit komplett eingestellt wurde – die Bremer Vulkan Verbund AG war insolvent. Damals hatte der Verbund 23.000 Beschäftigte in West- und Ostdeutschland. 9000 verloren ihre Jobs, davon mehr als 2000 in Bremen.
Aus der Bremer Vulkan-Werft war ein Untergang in Raten
Es war ein Untergang in Raten. Alle Hilfsversuche der vergangenen Jahre, das Traditionsunternehmen doch noch auf Kurs zu bekommen, waren gescheitert und beschäftigten noch jahrelang die Gerichte. Die Pleite des Vulkan und seiner dazu gekauften Werften in Ostdeutschland sowie anderen branchenfremden Unternehmen zu einem Gemischtwarenladen entpuppte sich als einer der größten Subventionsskandale Deutschlands – anders als bei der AG Weser, der anderen führenden Großbauwerft, die 1983 ohne öffentliche Milliarden-Subventionen in die Pleite ging.
Der Untergang des Vulkan ist eng verknüpft mit der Person Friedrich Hennemann, der im Juli 2020 im Alter von 84 gestorben und als sehr umstrittene Person in die Bremer Wirtschaftsgeschichte einging. Der SPD-Wirtschaftsstaatsrat galt als senatstreuer Beamter und wurde 1987 an die Konzernspitze berufen. In den folgenden Jahren konnte er schalten und walten wie er wollte. Öffentliche Kritik an seinem Kurs gab es nur von wenigen Personen – eine davon war Wirtschaftsprofessor Rudolf Hickel. Die Politik vertraute dagegen voll und ganz der groß angelegten Hennemann-Einkaufstour quer durch Deutschland.
„Wir stehen vor einem ozeanischen Jahrhundert", orakelte Hennemann damals. Sein Ziel: Er wollte die Werft zu einem globalen maritimen Technologiekonzern ausbauen. Entsprechend lang war seine Einkaufsliste: Neben Werften in Bremerhaven und Wilhelmshaven kauft e er die Maschinenfabrik Dörries Scharmann in Mönchengladbach, den Marine-Elektronikspezialisten Krupp Atlas und andere Firmen. Nach dem Mauerfall 1992 ging der Expansionskurs weiter: Übernommen wurden mit den Werften in Wismar, Stralsund und dem Dieselmotorenwerk Rostock fast die gesamte ostdeutsche Werftindustrie.
Warum der Bremer Vulkankomplex am Ende nicht mehr zu retten war
Hennemann habe Betriebe aufgekauft , die pleitegegangen waren, und sie richtig groß machen wollen, so Bremens ehemaliger Bürgermeister (1995–2005) Henning Scherf (SPD) im August 2017 im Gespräch mit dem WESER-KURIER als sich das Aus des Vulkan zum 20. Mal jährte. „Seine Idee: Ich muss die Werft so groß machen, dass die Politik mich, wenn ich nicht mehr weiterkann, rettet. Das war Spekulation auf Steuergelder.“ Hennemann sei mit öffentlichen Geldern verantwortungslos umgegangen und keiner habe ihn aufgehalten. Dass seine Kritik wenig Gehör fand, ärgert Hickel noch heute. „Am Ende war der maritim-industrielle Vulkankomplex nicht mehr zu retten“, sagt Hickel.
„Die Ursachen liegen in der unter dem Hennemann-Management betriebenen Unternehmenspolitik seit der 1980er-Jahre.“ Mit der Verschmelzung früherer selbstständiger Werften zum Vulkan-Werftenverbund und ab Anfang der 1990er-Jahre die dann folgende Eingliederung der ostdeutschen Werften sei die Entwicklung zum Zusammenbruch programmiert gewesen. „Die Strategie lautete: Expansion nicht unbedingt nach dem Motto ‚big is beautiful‘, sondern: Ausbau zum maritimen System, mit dem der Druck auf die Politik steigt, zur Vermeidung des Systemrisikos öffentliche Mittel zur Verfügung zu stellen.“
Dazu habe Hennemann seine Vision vom „ozeanischen Jahrhundert“ mit den Meeresschiff -„Autobahnen“ geliefert. „Die Kurzsichtigkeit des Konzepts zeigte sich an der Unterschätzung der internationalen Konkurrenz und vor allem durch die Verdrängung der öko-logischen Belastungen und Barrieren.“
Der Bremer Vulkan war eine Werft, die über Jahre im nationalen und internationalen Schiffbau den Takt mit vorgab und einige Krisen gemeistert hatte. Außerdem prägte sie maßgeblich ihre Stadtteile und waren Arbeitgeber für viele Familie und das häufig über Generationen. Wer nach Walle, Gröpelingen oder Vegesack zog, der machte das häufig, um beim Vulkan oder der AG Weser zu arbeiten.
Bei Martin Rudolf Bogaczynski war das nicht der Fall: „Ich bin in der Nähe der Werft aufgewachsen, fast um die Ecke von Wätjens Park, wo die Zentrale des Vulkan stand.“ Was er später mal für einen Beruf erlernen wird, war eigentlich klar. „Darüber machte man sich gar keine Gedanken. Mein Großvater fing kurz nach der Gründung 1893 auf dem Vulkan an, mein Vater war von 1925 an über 45 Jahre auf der Werft beschäftigt, und ich fing 1955 mit achtzehn Jahren als Dritter der Generation Bogaczynski mit einer Ausbildung zum Maschinenschlosser dort an.“
Vulkan war mal Vorreiter der Branche
Nach Abschluss der dreijährigen Ausbildung kam für Bogaczynski das plötzliche Aus beim Vulkan, er blieb der Werft aber eng verbunden – später auch beruflich. „Ich bin quasi aus Deutschland geflohen, um so nicht bei der gerade gegründeten Bundeswehr eingezogen zu werden.“ Sieben Jahre verbrachte er deshalb im Ausland: Er war in den USA, Kuba, Brasilien und Argentinien. „Nach einer Reise von Kanada über 35.000 Kilometer bis Feuerland in sieben Monaten bin ich dann 1965 nach Deutschland zurückgekehrt, um Betriebswirtschaft und anschließend Maschinenbau zu studieren.“
Bogaczynski war häufig beim Vulkan. „Ich hatte für Rheinstahl-Thyssen gearbeitet, wir lieferten den Stahl für die Schiffssektionen. Ich war einmal die Woche in Vegesack. Zu der Zeit liefen die Geschäfte noch gut.“ Der Vulkan sei führend im Frachtschiff – und später im Containerschiffbau unterwegs gewesen und hat neu entwickelte Serien wie die Stein-Klasse für den Norddeutschen Lloyd gefertigt und war später auch für Hapag-Lloyd die Werft.“
Auch in den Jahrzehnten davor habe die Werft oft bewiesen, weshalb sie so erfolgreich war. „Beeindruckend war für mich persönlich auch der Umbau der vor dem Zweiten Weltkrieg in Frankreich fertiggestellten Passagier- und Frachtschiff es ,Pasteur‘, das jahrelang als Truppentransporter für die Engländer und später für die Franzosen im Indochinakrieg diente.“ Der Norddeutsche Lloyd erwarb das Schiff 1957 für 30 Millionen Mark und ließ es für über 60 Millionen Mark auf dem Vulkan zum Passagierschiff „Bremen“ umbauen.
Rudolf Bogaczynski über Vulkan: Spezialisierung wäre nötig gewesen
Dass der Vulkan Pleite ging, lag nach Ansicht von Bogaczynski daran, dass er es nicht schaffte, sich zu spezialisieren. „Das wäre nötig gewesen, um ein Segment zu finden, in dem die Billigkonkurrenz aus dem Ausland nicht tätig war.“ Dafür habe in der Konzernleitung der letzten Jahre unter Hennemann das maritime Know-how gefehlt, um die richtigen Weichen zu stellen. Aus Hickels Sicht haben auf verschiedenen Ebenen strategisch-operative Fehler zum Untergang des Vulkan-Verbundes geführt: Der Konzern sei statt als Team autoritär zugespitzt und intransparent durch Hennemann geführt worden. Durch den Zusammenkauf mehrerer Werften sowie den Zukauf des Maschinenbauers Dörries-Scharmann und von Atlas Elektronik sei ohne die Wirkung der versprochenen Synergieeffekte ein kaum noch steuerbarer Gigant entstanden.
Ebenfalls seien durch das zentrale Cash-Management die Stand-orte mit guten Ergebnissen im Verbund und damit der Einsatz deren Gewinne für Investitionen benachteiligt worden. Diese Zentralisierung der Kasse sei auch dazu genutzt worden, Treuhandmittel im Umfang von 432 Millionen D-Mark als Beihilfe für die ostdeutschen Standorte, unter anderem auch zum Kauf des Maschinenbauers Dörries-Scharmann, zu verwenden. Jedenfalls habe der Konkursverwalter Jobst Wellensiek später festgestellt: Das Geld sei weg.
Außerdem sei konsequent nach dem Prinzip des Zentralismus bei einzelnen Standorten zu wenig in die Zukunft investiert worden, sagt Hickel. „Ein damals von Staatsrat Heiner Heseler und mir zu den Investitionsdefiziten bei der Schichau-Seebeck-Werft für den Betriebsrat vorgelegten Gutachten hat Friedrich Hennemann als schamlosen Angriff auf den Bremer Vulkan abgekanzelt.“ Hinzu sei gekommen, dass bei den Unternehmensentscheidungen der Werftenstandorte die massive Veränderung durch die internationale Konkurrenz nicht ausreichend strategisch berücksichtigt worden sei.
Vulkan-Aufsichtsrat war eher Erfüllungsgehilfe als Kontrolleur
Dass es kaum Kritik an der Vulkan-Konstruktion gab, hatte aus Sicht von Hickel mehrere Gründe: „Hennemann war mit zu viel und dann auch noch autoritär genutzter Macht ausgestattet.“ Innerhalb des Konzerns habe es keine funktionierende Kontrolle gegeben. Der Aufsichtsrat war viele Jahre eher Erfüllungsgehilfe als Kontrolleur. „Ein Vorstandsmitglied erklärte mir persönlich, dass konstruktiver Widerspruch gegen den, Chef, als ,Majestätsbeleidigung‘ empfunden wurde. Das Hennemann-System habe mit seinem Versprechen, die Produktionsstandorte und damit die Arbeitsplätze zu sichern, die Politik in dessen Abhängigkeit gebracht. Berechtigte Kritik habe bei der Politik im kurzsichtigen Schulterschluss mit den Betriebsräten kein Gehör gefunden. „Ich selbst habe den damaligen Bürgermeister über die massive Kritik aus der Industrie am aggressiven Verhalten Hennemanns informiert. Mit dem Slogan, ,Fritz, der die Kohlen aus dem Feuer holt‘, prallte Kritik an der Politik ab.“ Sicherlich hätten auch die Banken, die auch noch in der Phase aufkommende Probleme und das Geschäftsgebaren akzeptierten, Schuld am Debakel. „Auch die Vulkan-Story lehrt, dass die Kredite gebenden Banken als Garanten für ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell oftmals versagten.“
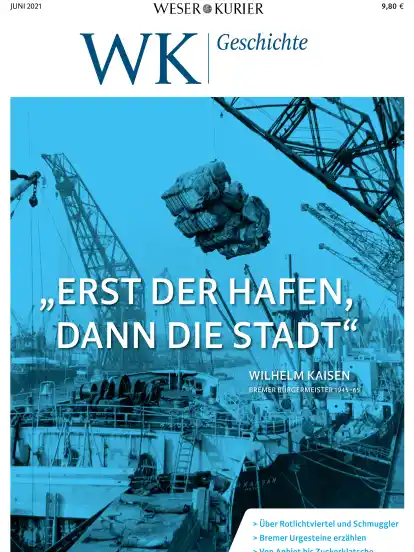
Im Magazin "Erst der Hafen, dann die Stadt" blicken wir auf die bremischen Häfen und ihre Geschichte. Hier gelangen Sie direkt zur Bestellung in unserem Shop.
Um den Absturz zu verhindern, wäre es notwendig gewesen, „diesen in-transparenten Hennemann-Komplex nicht entstehen zu lassen“, sagt Hickel. „Wichtig wäre es gewesen, eine Diversifikation der Standorte mit vergleichs-weise selbstständigen Werftstandorten zu sichern.“ In diesem Prozess hätten einzelne Produktionsschwerpunkte – beispielsweise im Bereich Containerschiffe – unter dem Druck der Konkurrenz aus China, Korea und Japan sozial verträglich geschlossen werden können. „Meine Botschaft nach zwei Reisen nach Südkorea zu dortigen Werften war: Gegenüber diesen Standardschiffen haben wir in Deutschland keine Chancen.“ Auf der Basis selbstständiger Werftenstandorte hätte der Umstieg in den Neubau von Spezialschiffen, die Reparatur und den Komponentenbau gestärkt werden können. „Kleinteiliger und risikodiversifizierter hätte der Konkurrenz besser Paroli geboten werden können. „Dieser risikodiversifizierte Umbau sei erst nach dem Zusammenbruch des Vulkan-Komplexes eingeleitet worden. Dafür steht heute die Rönner-Gruppe in Bremerhaven.“
Der Vulkan habe es nicht geschafft, die Werften vernünftig zu integrieren und zusammenzufügen, sagt auch Heseler rückblickend. Geld habe es genug gegeben, „insgesamt sechs Milliarden D-Mark waren ja eine enorme Summe“. Nach Liquiditätsproblemen trat Hennemann auf Druck der Banken 1995 zurück. Danach begann das große Aufräumen. Untersuchungsausschüsse in Bonn, Bremen und Schwerin stellten später fest: Subventionsmentalität, ein unüberschaubares Geflecht von Beteiligungen und mangelhafte Kontrolle hätten zum absehbaren Crash geführt. Die Treuhandnachfolgerin BVS stellte Strafanzeige gegen den früheren Vulkan-Vorstand wegen zweckwidriger Verwendung von Beihilfen in dreistelliger Millionenhöhe. EU-Fördergelder für Ost-Werften sollen in maroden West- Firmen des Verbundes versickert sein. „Das Geld ist weg“, konstatierte Konkursverwalter Jobst Wellensiek lakonisch. Das Verfahren gegen Hennemann wurde nach 14 Jahren mit Prozessen und Revisionen eingestellt.
- Dieser Text stammt aus dem Magazin "Erst der Hafen, dann die Stadt" über Bremen und seine Häfen der Reihe WK|Geschichte.







