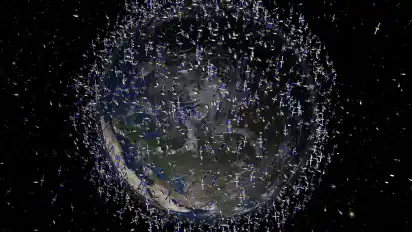Aus dem Weltall zu erkennen, ob ein Acker ausreichend gewässert ist, ein See voller Algen steckt oder ein Wald kurz vor dem Vertrocknen steht, stellt keine ganz einfache Aufgabe dar. Aber der neue Umweltsatellit EnMAP soll genau das leisten: In nie gekannter Detailschärfe soll er aus 650 Kilometern Höhe die Erde im Blick behalten, Böden und Gewässer scannen und den Wissenschaftlern präzise Daten über den Fortgang des Klimawandels liefern – "ein hervorragendes Beispiel dafür, wie modernste Raumfahrttechnik zum Wohle der Menschheit und der Umwelt eingesetzt werden kann", meint die neue Raumfahrtkoordinatorin der Bundesregierung, Anna Christmann (Grüne).
Noch steht der scharfsichtige Späher – etwas größer als ein Kleiderschrank – für letzte Tests in der Reinraumhalle beim Bremer Satellitenbauer OHB. Ende des Monats jedoch soll er in einen Container verpackt und per Frachtflug nach Florida verschickt werden. Anfang April, so der aktuelle Zeitplan, wird eine Falcon-9-Rakete die 300 Millionen Euro teure Fracht von Cape Canaveral ins Weltall schießen.
Dann wird endlich Realität, worüber die Wissenschaftler am Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam vor 20 Jahren zum ersten Mal nachgedacht hatten. Fotos und Radarbilder von der Erde gab es auch damals schon reichlich. Noch viel genauer und aussagekräftiger aber wären Aufnahmen, die das gesamte Spektrum des Lichts von Ultraviolett bis zum langwelligen Infrarot erfassen würden. Die Wissenschaftler nennen diese Bandbreite "hyperspektral". Statt wie eine Fotokamera das Licht auf nur drei Kanälen – Blau, Grün und Rot – zu erfassen, soll der Satellit 240 Farbkanäle abdecken.
Start sollte schon 2009 sein
"Mit EnMAP haben wir das zu 100 Prozent so realisiert wie geplant", freut sich Harald Schuh, Direktor des GFZ-Departments Geodäsie. "Es hat nur länger gedauert als geplant." War der Start des Satelliten zunächst für 2009 vorgesehen und dann für 2013 fest geplant, ist es nun 2022 geworden, bis EnMAP abhebt. Denn die technischen Probleme bei der Entwicklung waren immens. Hyperspektralsensoren wurden bislang nur von Flugzeugen aus eingesetzt, nicht in Satelliten, wo jedes Gramm und jeder Quadratzentimeter zählt. "Die Komplexität der Sensorik hat uns wirklich an die Grenzen des physikalisch Möglichen gebracht", räumt Marco Fuchs ein, Chef der Herstellerfirma OHB.
Der Instrumententeil des Satelliten, der im OHB-Werk in Oberpfaffenhofen bei München gebaut wurde, ist vollgestopft mit Linsen und Prismen, die das von der Erde reflektierte Sonnenlicht in seine Bestandteile zerlegen. Diesen Glaskasten heil an der Spitze einer donnernden Rakete ins Weltall zu befördern, ohne einen Scherbenhaufen zu hinterlassen, ist der eine Teil des Problems.
Der zweite: Oben angekommen, muss das Hochleistungs-Instrument vor den enormen Temperaturschwankungen geschützt werden. Zwischen minus 100 und plus 90 Grad ist im All alles drin – zu viel für die empfindliche Sensorik. Die Ingenieure entschieden sich für den Einbau einer Art Klimaanlage, die die Temperatur im Inneren des Satelliten konstant bei 20 Grad halten soll.
Auch wenn der Start fast zehn Jahre später als geplant erfolgt und die Kosten mit 300 Millionen Euro astronomische Höhen erreichten, sieht man sich im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit EnMAP an der Weltspitze: "Bei der Hyperspektralanalyse aus dem Weltall haben wir international die Nase vorn", versichert DLR-Vorstandsmitglied Walther Pelzer. Mindestens fünf Jahre lang, wahrscheinlich eher zehn bis 15, soll EnMAP seine Daten zur Erde funken. Wissenschaftlern sollen sie genaue Hinweise über den Zustand von Wäldern, Seen und Böden im Zeitalter des Klimawandels liefern. Geplant sind aber auch ganz praktische Anwendungen: Landwirte etwa, die wissen wollen, ob ihre Pflanzen ausreichend mit Nährstoffen versorgt werden, sollen auch auf die EnMAP-Daten zurückgreifen können. "Unser Ziel ist es, dass wir das über eine Plattform kostenlos anbieten", sagt DLR-Vorstand Pelzer. "Und wir sind zuversichtlich, dass das auch funktioniert."