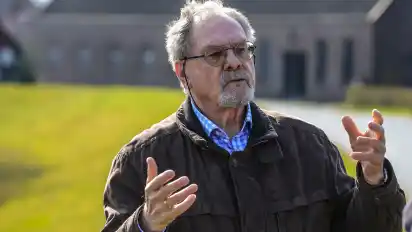Ernteverluste und Waldschäden durch Dürren, zerstörte Infrastrukturen und Tote durch Überschwemmungen. Und außerdem Nutzungseinschränkung für das Trinkwasser: Die Folgen der Klimakrise auf das Wasser sind in Deutschland bereits zu spüren. Dabei steht die eigentliche Krise mit weit gravierenderen Folgen erst in den kommenden Jahrzehnten an.
Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat deshalb eine Nationale Wasserstrategie vorgestellt. Bis 2050 soll Deutschland damit besser an die Effekte des Klimawandels angepasst werden. Der Bremer Hydrogeologe Nils Moosdorf erläutert, was die Wasserstrategie leisten kann und muss.
Warum benötigt Deutschland eine Nationale Wasserstrategie?
Nils Moosdorf: Als ich vor fast 20 Jahren studiert habe, habe ich gelernt, dass Deutschland genug Wasser und Trinkwasser hat, dass keine Probleme zu erwarten sind. 20 Jahre später sehen wir schon jetzt signifikante Änderungen in unserem Wasserhaushalt und Dürreereignisse. Wir brauchen eine Strategie, weil wir sonst Probleme kriegen mit der Trinkwasserverteilung und -verfügbarkeit. Wir brauchen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel.
Sind die Probleme wirklich so groß?
Besonders relevant sind die Extremereignisse, die auch noch stärker werden. Auf Starkregen oder Dürre muss man sich einstellen. Schon jetzt haben wir große Waldschäden, Ernteausfälle und Niedrigwasser im Rhein, wodurch Industriebetriebe ihre Rohstoffe nicht mehr bekommen haben. An der Weser sieht man stromaufwärts große Salzeinleitungen von Salzbergwerken. Damit das ökologisch verträglich ist, müssen sie durch das Wasser, das in der Weser fließt, verdünnt werden. Sonst kann passieren, was wir letztes Jahr beim Fischsterben in der Oder gesehen haben.
Müssen wir mehr Wasser sparen?
Wasser sparen macht auch dort Sinn, wo es genug gibt. Man muss ja nichts verschwenden, nur weil es da ist. Aber bundesweit haben wir noch immer eine intensive Dürre. Man denkt oft, nach einem starken Regen ist alles wieder gut, aber der Wasserkreislauf, insbesondere das Grundwasser, reagiert sehr langsam und braucht lange Regenphasen, um sich zu erholen. Auch im Süden von Bremen haben wir noch eine deutliche Dürresituation.

Nils Moosdorf forscht in Bremen zum Thema Wasser.
Wie kann die Wasserstrategie diese Entwicklungen beeinflussen?
Beeinflussen hieße, den Klimawandel zu reduzieren. Das wäre natürlich die beste Maßnahme. Wenn man das nicht schafft, muss man parallel darauf hinarbeiten, sich besser anzupassen. Ein Beispiel ist das Schwammstadtkonzept: Damit bei Starkregen die Kanalisation nicht überfordert wird, wird das Wasser gezielt an bestimmte Orte laufen gelassen und versickert vor Ort. So kann zugleich Wasser für Trockenzeiten zurückbehalten werden. Denn Wasser, das im Fluss abläuft, ist nicht mehr verfügbar. Ein weiteres Beispiel ist das Grundwasser. Durch die Flächenversiegelung bildet sich weniger Grundwasser neu, weil das Wasser schnell abfließt. Die Wasserstrategie fordert, Grundwasser besser zu managen, damit mehr zur Verfügung steht. Denn Grundwasser ist ein wichtiger Puffer für Wetterereignisse.
Was steht noch in der Nationalen Wasserstrategie?
Als wichtiges Ziel soll der natürliche Wasserhaushalt gefördert und geschützt werden. Wasser und Grundwasser sauber zu halten, ist besonders ein norddeutsches Thema, weil hier viel Nitrat aus der Landwirtschaft eingetragen wird. Auch die Meeresgebiete sollen vor Stoffeinträgen geschützt werden. Das Umweltministerium möchte außerdem die Infrastrukturen weiterentwickeln und beispielsweise Überlandwasserleitungen bauen. Falls eine Region unter Dürre leidet, können dann wasserreiche Gebiete Wasser abgeben.
Warum geht es bei der Nationalen Wasserstrategie auch ums Ausland?
Es gibt in der Welt große Gebiete ohne sauberes Wasser. Das zu ändern ist ein Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen, aber auch für uns wichtig: Wir beziehen Lebensmittel aus allen Ecken der Welt. Es ist unser Interesse, dass das Wasser dort sauber ist. Außerdem fehlen Lebensgrundlagen, wenn es nicht genug Wasser gibt. Das führt zu Konflikten, die teilweise schon mit Gewalt ausgetragen werden, auch zu Konflikten zwischen Staaten. Das gibt es auch schon in Deutschland: Gerichtsverfahren zwischen Nachbargemeinden, Privatleuten und Unternehmen haben zugenommen, die sich um die Wasserverteilung drehen, um die Frage, wer darf wie viel entnehmen. Daran merkt man, dass Wasser gefühlt und real knapper wird.
Wie Maßnahmen sind sinnvoll?
Die Perspektive der Strategie ist das Jahr 2050. In der Umsetzung ist vieles jedoch Ländersache. In Bremen gibt es schon Maßnahmen: eine Klimaanpassungsstrategie, Gefahrenkarten für Starkregenereignisse, die zeigen, bei welcher Regenmenge wird welche Straße wie hoch unter Wasser stehen sowie Fördermaßnahmen für die Regenwasserversickerung im eigenen Garten. Generell müssen wir versuchen, das Wasser dort zu behalten, wo es ist, für Starkregen durch Wasserspeicher vorsorgen – da helfen schon begrünte Dächer, weil sie die ersten Millimeter Niederschlag speichern. Wir müssen schauen, dass Böden aufgelockert sind und nicht durch die Landwirtschaft zu stark verdichtet, uns Gedanken machen, ob wir die richtigen Lebensmittel anbauen für die zu erwartende Witterung. Natürliche Flussläufe sind ebenfalls Wasserspeicher: Auen werden bei Hochwasser überschwemmt, speichern Wasser und sorgen für eine entspanntere Lage flussabwärts, weil das Wasser langsamer abfließt.
Was fehlt in der Wasserstrategie?
Ich finde die Strategie ziemlich rund und gut durchdacht. Es ist gut, dass wir uns jetzt damit beschäftigen, obwohl es so wirkt, als wäre es noch nicht so dringlich. Sinnvoll ist auch, Wasser-, Energie- und Stoffkreisläufe zu verbinden, weil sie real verbunden sind. Die Strategie zeigt außerdem, welche Kosten die Anpassung an den Klimawandel verursacht. Das vermisse ich oft in der Diskussion darüber, wie teuer Klimaschutz sei. Das Teuerste ist, Klimaschutz nicht zu machen und sich anpassen zu müssen.
Wie realistisch ist die Umsetzung?
Gerade nach den Dürren der letzten Jahre sieht man oft ein Umdenken und dass sich die Verwaltungen kümmern. Ob das Thema aber schon wichtig genug genommen wird, ist die Frage. Im Detail gibt es viel Widerstand, aber viele wollen in die richtige Richtung gehen.
- Das Gespräch führte Björn Lohmann.