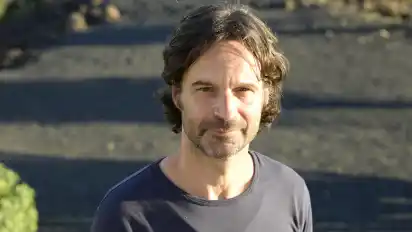Die uralte Seuche hat Amerika im Griff: das Lügenvirus. Und so verbreitet selbst der Handelskammervorstand im kalifornischen Städtchen Fulda die Nachricht, "dass ein unschuldiges Mädchen aus South Beach in der Garderobe des Senats in Washington gefangen gesetzt worden sei, weil es öffentlich enthüllt habe, dass das Steuerformular 1040 zu Ehebruch, Unfruchtbarkeit und Hodenkrebs führe".
Eine groteske Geschichte, wie sie der Journalist Boyd Halverson in die Welt hätte setzen können, die Hauptfigur im Roman "America Fantastica" von Tim O’Brien, dem kritischen Vietnam-Veteran unter den US-Autoren.
Boyd, der Pulitzer-Preis-Anwärter, wurde als Fake-News-Creator entlarvt und entlassen, ein amerikanischer Claas Relotius, der "faule, unbeirrbare Atem der Verschwörungstheoretiker, die Obama für einen Ausländer halten und die Schießerei von Ruby Ridge für einen Freiheitskampf". Er hat sich zuletzt als Kaufhausclown durchgeschlagen und hängt nun während der Corona-Pandemie unter Donald Trumps erster Präsidentschaft etwas zu eng an der Flasche. Kurzentschlossen überfällt er eine Bank, erbeutet 81.000 Dollar (nur wenig mehr als seine eigenen Rücklagen) und nimmt die so freche wie fromme Kassiererin Angie Bing als Geisel. Mit ihr fährt er erst nach Mexiko, wo beide einen Teil der Beute verprassen, dann nach Los Angeles zu seinem Elternhaus.
Rache am Ex-Schwiegervater
Was er nicht weiß: Das Ehepaar Douglas und Lois Cutterby, Geschäftsführer der Bank in Fulda, haben ihr Institut heimlich um vier Millionen Dollar erleichtert und deshalb überhaupt kein Interesse, den Räuber verfolgen zu lassen. Statt der Polizei ist ihm Randy, Angies Freund und schlagkräftiger Schmalspurganove, auf den Fersen, außerdem Henry Speck, der für den neuen Ehemann von Boyds Ex-Frau die Drecksarbeit macht, und Toby, ein von den Cutterbys bestochener Polizist. Derweil möchte sich Boyd an seinem Ex-Schwiegervater rächen, den er für sein Elend verantwortlich macht.
Das klingt, als könne daraus ein actionreiches Roadmovie werden, allerdings fehlt es der Geschichte des 78-jährigen O’Brien an einem klaren Handlungsfaden und Charakteren, die das Interesse über 500 Seiten wachhalten könnten. Die Verfolger kommen Boyd kaum einmal nahe, und der gescheiterte Journalist erscheint weniger als gewiefter Trickser denn als schlaffe Ausgabe des literarischen Urbildes aller Durchschnittsamerikaner, dem Mr. Babbit von Sinclair Lewis. So plätschert das Geschehen überraschend ruhig dahin, aufgeschreckt nur durch satirische Einschübe über das lügenhaften Amerika unter Trump. Und die wirken fast hilflos, weil die miese Wirklichkeit kaum zu toppen ist.
Die ganze Tragik der USA
So erfreut sich der Leser vor allem an manch gelungener Sentenz am Rande. Etwa wenn der Autor feststellt "Das Material, aus dem diese Welt bestand, war ermüdet" oder die amerikanische Mama als fett, aber unzerstörbar beschreibt. "Ihm war klar, dass es ein böses Ende nehmen würde, aber für den Augenblick fiel es ihm schwer, sich deswegen Gedanken zu machen." In diesem Satz des Bankräubers ohne Perspektive und Zukunft scheint die ganze Tragik der USA und der modernen Zeit gebündelt.