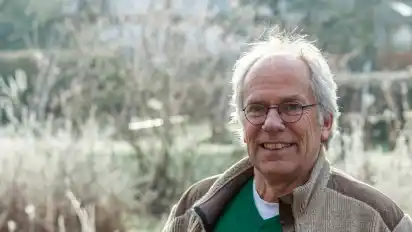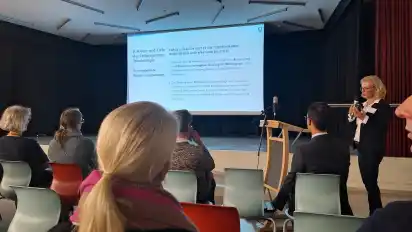Die Politik muss deutlich machen, wohin es gehen soll. Aus Sicht von Hans-Gerhard Kulp von der Biologischen Station Osterholz (Bios) ist dies ein wichtiger Punkt, wenn es um den Klimaschutz geht. Klimaschutz sei als allgemeines Ziel in der Politik inzwischen anerkannt, glaubt er. Das Thema dürfte also jede Partei berühren. Egal, welche Parteien nach der Bundestagswahl am 23. Februar regieren werden: Die Politik müsse den Bürgern klar machen, dass sich beim Thema Klimaschutz noch mehr ändern muss. Die Notwendigkeit einer Transformation müsse in der Gesellschaft ankommen. Und dies zu verdeutlichen, sei nach seiner Erwartung Aufgabe der kommenden Regierung.
Es gebe bereits viel Geld und Angebote für den Moorschutz und das Moor ist der größte CO2-Speicher in der Region, aber auch eine Fläche, die beispielsweise durch die Nutzung durch die Landwirtschaft viel CO2 abgibt. Moorschutz müsse gewollt sein, bemerkt Kulp, dass es auf die Akzeptanz vor Ort ankomme. „Der Prozess läuft hier an der Basis.“ In dieser Hinsicht sei man aber vorangekommen. Es liefen derzeit Pilot-Projekte, die auf eine Änderung von landwirtschaftlich genutzten Flächen im Moor abzielen. Ziel sei es unter anderem, durch Wiedervernässung dafür zu sorgen, dass die Moore weniger Treibhausgase freisetzen. Wenn die Landwirte aber dazu beitragen und ihre Betriebe umstellen sollen, brauchten sie dafür Planungssicherheit. Klarheit sei auch für Bürger und Unternehmen wichtig. Und da könne die Bundespolitik laut Kulp etwas tun: „Das Hickhack der Parteien muss aufhören.“ Der Konsens für den Klimaschutz werde ständig infrage gestellt. Beispiel Auto: Erst werde das Aus für Verbrennerfahrzeuge verkündet, kurz darauf werde dieser Beschluss mit der Forderung nach Technologieoffenheit wieder relativiert. Es entstehe der Eindruck, es könne alles verschoben werden, es sei ja noch Zeit.
Das sei nicht nur schädlich für das Ziel Klimaschutz, sondern auch unfair gegenüber Herstellern. Das Gerede über die Wärmepumpe habe den Markt kaputtgemacht. Die Unternehmen säßen nun auf den gefertigten Geräten, während viele Verbraucher noch abwarteten. Auch die Autoindustrie brauche eine klare Richtung, damit sie wisse, worauf sie hinzuarbeiten habe. Genauso wie die Landwirte, denen es um Planungssicherheit gehe, wenn sie beispielsweise besagte Umstellung auf die Bewirtschaftung wiedervernässter Moorflächen stemmen sollen. Um das Klima wirklich schützen zu können, sei alles in allem eine umfangreiche Transformation in vielen Lebensbereichen notwendig. „Dafür muss der Staat in Vorleistung gehen“, findet der Biologe. Der Staat müsse also den Prozess finanziell unterstützen und für Kontinuität sorgen. Damit das Land später davon profitieren könne.
Immerhin, ein Anfang sei in der Vergangenheit schon mal gemacht worden: Nach einer Reihe von Demonstrationen im Jahr 2019 hatte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel Expertinnen und Experten aus Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft, Verbraucher-, Umwelt- und Tierschutz zusammengeholt, um den Zwist zu beruhigen. Die sogenannte Zukunftskommission Landwirtschaft verabschiedete 2021 nach zweijähriger Arbeit konkrete Vorschläge. „Es geht beispielsweise um eine Reduzierung von Pestiziden, mehr Regionalität, mehr Tierwohl, weniger Fleischverzehr, was zu weniger Gülle und weniger Futter führt“, zählt Hans-Gerhard Kulp beispielhaft auf. Entsprechende Gesetze zur Umsetzung habe es indes nur marginal gegeben. Kein Grund aufzugeben, sondern vielmehr ein Anknüpfungspunkt, appelliert Kulp an die kommende Regierung: „Die Elemente müssten in der kommenden Legislaturperiode angegangen werden.“
Einen Punkt hat Hans-Gerhard Kulp aber noch, der ihm auf den Nägeln brennt, aber nur mittelbar mit der Bundespolitik zu tun hat: die Bundesstraße 74 neu, die als Projekt im Bundesverkehrswegeplan 2030 verankert ist. Inzwischen, so Kulp, gibt es ein Klimagesetz, das unter anderem eine Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene und den Öffentlichen Nahverkehr priorisiere. Die Planer der B74 dürften aber nur Straßen planen und nicht über den Tellerrand schauen. Das passe nicht zusammen. Kulp fordert, das Projekt zu stoppen. Grundsätzlich gehe Erhalt vor Neubau. Und: „Wir brauchen das Geld für die Brücken.“
Was sagen die Direktkandidaten zum Thema?
Wir haben den Direktkandidaten der sechs im Deutschen Bundestag vertretenden Parteien im Wahlkreis Verden-Osterholz die Frage gestellt, wie Klimaschutz und Wirtschaften im Moor zu vereinbaren sind. Das sind ihre Antworten:
Herbert Behrens (Die Linke):
Die Ampel hat den Klimaschutz massiv geschwächt, indem sie Sektorziele im Klimaschutzgesetz abschaffte. Die landwirtschaftliche Produktion muss ihren Anteil leisten. Eine sozialverträgliche Transformation der Moornutzung ist anzustreben. Die Erkenntnisse aus entsprechenden Projekten in Niedersachsen müssen realisiert werden. Die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) enthält eine konkrete Vision zur Erhaltung der Biodiversität der Moore. Die Bundesländer sind im Wesentlichen für die Durchführung von Moorschutzmaßnahmen verantwortlich. Förderprogramme und staatliche Infrastrukturprogramme müssen den Umbau unterstützen, um eine klimaschonenden Bewirtschaftung von Moorböden nachhaltig zu etablieren. Aspekte des Klimaschutzes von Mooren spielen dabei zunehmend eine Rolle.
Lena Gumnior (Bündnis 90/Die Grünen):
Moore sind riesige CO₂-Speicher und können im nassen Zustand eine CO₂-Senke sein. Doch in Niedersachsen machen ausgetrocknete Moorböden 18 Prozent der CO₂-Emissionen aus. Diese Flächen werden größtenteils landwirtschaftlich genutzt, jedoch sind die Landwirtinnen und Landwirte nicht schuld an der Situation: Die Trockenlegung war einst eine staatlich geförderte Kulturleistung. Um Klimaschutz und Wirtschaft zu vereinen, setze ich mich dafür ein, dass die Flächen wiedervernässt und für nachhaltige Nutzung wie Paludikultur umgestellt werden. Pflanzen wie Schilf und Rohrkolben bieten Potenzial für neue Wertschöpfungsketten, etwa als Dämm- oder Baustoffe. Damit schaffen wir klimafreundliche Alternativen, reduzieren Emissionen und würdigen gleichzeitig das Generationenwerk der Landwirtinnen und Landwirte.
Gero Hocker (FDP):
Eine schlagkräftige landwirtschaftliche Produktion von Lebensmitteln brauchen wir in Deutschland ausdrücklich auch auf den Moorstandorten. Sie wurden über Jahrzehnte kultiviert als die Lebensmittelversorgung noch nicht so sicher war wie es heute scheint. Torfabbau mit Augenmaß ist zudem eine Grundlage für Hobbygärtner und den professionellen Gartenbau. Im Anschluss wird auf den Abbauflächen eine Hochmoorregeneration ermöglicht. Es bildet sich eine potenzielle CO2-Senke. Kooperation ist der Schlüssel, um sinnvolle Maßnahmen auf freiwilliger Basis durch Vertragsnaturschutz umzusetzen. Für Abbau- und Naturschutzmaßnahmen ist Voraussetzung, dass umliegende landwirtschaftlichen Flächen nicht geschädigt werden, etwa die Entwässerung. Es darf keine Enteignungen durch die Hintertür geben.
Özge Kadah (SPD):
Moore sind bedeutende CO₂-Speicher und spielen eine zentrale Rolle im Klimaschutz. In Niedersachsen bedecken sie etwa acht Prozent der Landesfläche, was uns eine besondere Verantwortung verleiht. Die Wiedervernässung und nachhaltige Nutzung von Mooren bieten die Chance, Klimaschutz und wirtschaftliche Interessen miteinander zu vereinen. Mit gezielten Förderungen kann der Übergang erleichtert und die Umstellung für betroffene Betriebe unterstützt werden.
Andreas Mattfeldt (CDU):
Klimaschutz und Wirtschaft dürfen in den Diskussionen nicht immer gegeneinander ausgespielt werden. Fakt ist, dass Klimaschutz bzw. der Umbau unsers Energiesystems zur Unabhängigkeit von autokratischen Staaten in Deutschland eine große Herausforderung ist. Deutschland ist ein dicht besiedeltes Land und verfügt als exportorientierte Nation über große Gewerbe- und Industrieflächen. Es ist unmöglich, einen Nationalpark von der Größe des Saarlandes einzurichten, wie es in Flächenländern dieser Erde möglich ist. Dennoch gibt es Wege, beides in Einklang zu bringen. Moore sind unverzichtbare CO2-Speicher – mehr sogar als Wälder: Obwohl sie nur drei Prozent der weltweiten Landfläche bedecken, binden sie doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Wälder zusammen. Den Schutz der Moore werden wir mit den Grundstückseigentümern intensivieren und Anreize für Wiedervernässungsprojekte geben. Das steht einem nachhaltigen Wirtschaften im Moor nicht entgegen. Im Wahlkreis haben wir gemeinsam mit den Landwirten viel erreicht.
Susanne Rosilius (AfD):
Die Vereinbarkeit von Klimaschutz und Wirtschaft im Moor basiert auf fundierte Fachkenntnisse: Wiedervernässte Wiesen dürfen nicht mit Fotovoltaikanlagen belegt werden. Intakte Moore müssen geschützt und renaturiert werden. Verantwortungsvolle Lösungen sollten Mensch und Umwelt gleichermaßen berücksichtigen zum Beispiel durch nachhaltige Landwirtschaft. Entscheidungen müssen wissenschaftsbasiert und ideologiefrei sein. Mit politischen Rahmenbedingungen, den Klimaschutz fördern und wirtschaftliche Interessen vor Ort einbinden. So gelingt ein Ausgleich von Ökologie und Ökonomie.