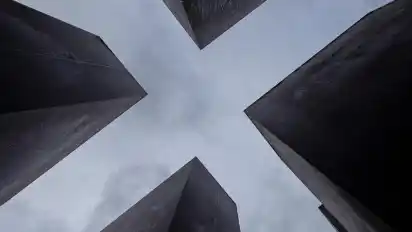38 Prozent der Juden in Europa haben schon eine Auswanderung in Erwägung gezogen, weil sie sich in der EU nicht mehr sicher fühlen. Eine alarmierende Zahl.
Katharina von Schnurbein: In den einzelnen Ländern gibt es laut dieser repräsentativen Befragung von 2018 von 16.500 Juden in der EU sehr große Unterschiede in der Auswanderungsbereitschaft. Zum Zeitpunkt der Umfrage war sie in Frankreich sehr hoch, in Deutschland ist die Situation meines Erachtens ein bisschen besser. Aber die Tatsache, dass Juden überhaupt darüber nachdenken, dass sie für sich und ihre Kinder keine Zukunft in Europa sehen, die ist besorgniserregend und auch gefährlich. Weil wir wissen: Wann immer Juden Europa verlassen haben, war es schlecht für Europa. Deshalb ist die Bekämpfung des Antisemitismus auch wirklich in unser aller Interesse und eben auch ein Kampf für die Demokratie und unsere Werte. Immer, wenn der Antisemitismus steigt, weiß man, dass auch andere Dinge im Argen liegen.
Können zum Beispiel auch die russischen Äußerungen über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj antisemitische Einstellungen befeuern?
Jede Situation, die in irgendeiner Weise als gefährlich wahrgenommen wird, führt zu Antisemitismus. Wir haben das gesehen in der Corona-Pandemie mit Verschwörungsmythen darüber, wie das Virus entstanden ist – und die Schuld der Juden daran. Und wir sehen es im Ukraine-Krieg mit einer sehr gezielten Propaganda von russischer Seite, die antisemitische Narrative bedient. Wir haben Daten ausgewertet, die zeigen, dass Kreml-nahe Quellen den Terminus Nazis bereits in den Monaten vor dem Krieg 200-mal häufiger benutzt haben als zuvor. Beim Wort Genozid war es sogar 400-fach. Aufseiten der jüdischen Gemeinden besteht die Sorge, dass so etwas in eine Sündenbock-Funktion umschlagen kann. So, wie das in der Vergangenheit immer wieder passiert ist. Das ist das Gefährliche und Schwierige des Antisemitismus-Virus: Es sucht sich immer wieder neue Wirte und bedient dabei die alten Vorurteile.
Übergriffe auf Juden, Beleidigungen, Anschläge auf jüdische Einrichtungen haben aber schon vor Pandemie und Krieg erheblich zugenommen. Wie erklären Sie sich das?
Der wichtigste Faktor ist das Internet. Antisemitismus und Hass verbreitet sich jetzt viel schneller und viel breiter. Das, was früher am Stammtisch stattfand, wo sich drei Leute getroffen und abgelästert haben – das steht heute alles im Netz. Auch zu Beginn der Corona-Pandemie explodierten förmlich Beiträge mit Bezug auf antisemitische Verschwörungsmythen. Das Internet diente ganz klar als Katalysator. Deswegen ist das Internet auch ein Hauptaugenmerk unserer Strategie gegen Antisemitismus. Der Digital Service Act, auf den man sich gerade auf EU-Ebene geeinigt hat, ist ein sehr wichtiges Instrument, das Transparenz schafft, uns bessere Beschwerdemechanismen und Bußgelder vorsieht, wenn sich die Plattformen nicht an die Vorschriften halten.
Die EU hat im Herbst 2021 eine Strategie zur Bekämpfung des Antisemitismus und zur Förderung jüdischen Lebens vorgelegt. An welchen Punkten setzt sie an, und was kann dieses Konzept über die Mitgliedsstaaten hinaus überhaupt bewirken?
Ansatz und Ziel ist, dass Juden für sich und für ihre Kinder und Kindeskinder eine Zukunft in Europa sehen. Und so, wie die Strategie auch sagt, eine EU, die frei ist von Antisemitismus. Das mag utopisch klingen, aber wir brauchen diese großen Ziele. Alles in dieser Strategie wirkt auf die Zusammenarbeit mit den Mitgliedsstaaten hin. Wir wissen natürlich, dass wir diese Ziele auf der EU-Ebene nicht allein erreichen können. Es braucht – und deswegen bin ich heute unter anderem hier in Bremen – die Zusammenarbeit auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Wo die Union mit Sicherheit neue Akzente setzen kann, ist die Bekämpfung des Antisemitismus im Internet. Da hat die EU einfach mehr Gewicht als ein einzelner Staat. Ein anderer Bereich ist die Vernetzung der verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel, wenn es um den Holocaust geht: Der ist natürlich von Deutschland geplant und durchgeführt worden. Aber ohne Kollaboration hätte die Judenvernichtung nicht so systematisch europaweit stattfinden können. Wir wollen das Projekt „Where the Holocaust happened“ initiieren – gerade auch in Ländern Osteuropas, die Opfer von Nazi-Deutschland waren, und wo man sich mit der Diskussion um Kollaboration schwertut. Wir wollen mit diesem Programm zum Beispiel Orte sichtbar machen, wo Juden deportiert oder versteckt wurden. Und damit sicherstellen, dass jetzt – da es immer weniger Zeitzeugen gibt – dieses Wissen auch weitergetragen wird. Wir setzen auch das Programm „Young Ambassadors for the Holocaust“ auf: Es vernetzt junge Menschen mit Zeitzeugen, um dann deren Geschichte weitererzählen zu können. Zudem setzt die Strategie beim Thema Sicherheit an: Es kann nicht sein, dass jüdische Gemeinden für ihre eigene Sicherheit zahlen müssen. In Deutschland und auch hier in Bremen ist das nicht der Fall. Aber in vielen EU-Staaten ist es tatsächlich so. Es wird doch auch von keiner anderen Gruppe erwartet, dass sie für ihre eigene Sicherheit zahlt. Denn Sicherheit ist Aufgabe des Staates und eine Voraussetzung dafür, dass man an einem Ort eine Zukunft sieht.
Mit der Sicherheit steht es nicht zum Besten, der Antisemitismus nimmt zu. Er findet vor allem bei Rechts- und Linksextremen, Verschwörungstheoretikern und bei in Deutschland lebenden Muslimen eine starke Verbreitung. Welche Gruppe macht die größten Probleme?
Gerade wurde der Bundesverfassungsschutzbericht vorgestellt. Darin wird ganz klar der Rechtsextremismus immer noch als die größte Bedrohung gesehen. Das liegt auch daran, dass diese Szene sehr strukturiert und vernetzt ist, Quellen und im Zweifelsfall auch Geld hat. Wenn wir von unserer Umfrage ausgehen, die 2018 unter Jüdinnen und Juden gemacht wurde, dann haben 41 Prozent im europäischen Durchschnitt angegeben, dass Attacken aus muslimischen Gemeinden kamen. Auch der linke Extremismus, wenn er auch weniger zur Gewalt neigt, ist eine große Gefahr. Vor allem diese drei Formen des Extremismus können sich alle darauf einigen, dass „der Jude“ oder Israel der Feind ist. In diesem Fall geht es um die Gefahr konkreter Attacken. Aber das, was wirklich den Alltag für Jüdinnen und Juden schwierig macht und auch das Klima vergiftet, ist der Antisemitismus aus der Mitte der Gesellschaft: etwa am Arbeitsplatz. Wenn beispielsweise ein Satz fällt wie: „Willst Du das nicht zahlen, Du hast doch Geld“ Und das gibt es in jeder Schicht. Darunter sind auch gebildete Menschen, die diese Form der Verschwörung und des Denkens verinnerlicht haben – und dann Judenwitze erzählen.
Das einzudämmen ist schwierig, oder?
Immerhin werden die Vorfälle mittlerweile viel besser erfasst. Der Anstieg an Vorfällen in Deutschland hat unter anderem auch damit zu tun, dass es jetzt Rias gibt, die Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus. Die haben einen Dachverband in Berlin und in einigen Bundesländern inzwischen Meldestellen – in Bremen leider nicht. Es ist wichtig, den Antisemitismus sichtbar zu machen, damit man ihn überhaupt bekämpfen kann. Und das gilt nicht nur für strafrechtlich relevante Fälle, sondern auch für Vorfälle, die unter einem Strafmaß bleiben. Durch diese Meldestellen werden wir ein viel klareres Bild bekommen, wie die gesellschaftliche Atmosphäre wirklich ist.
Das Gespräch führte Norbert Holst.