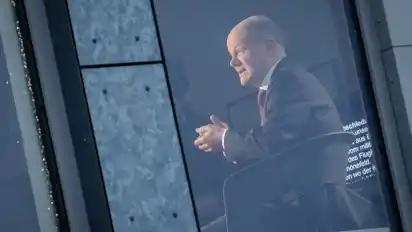Eigentlich gibt es für Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Antrittsbesuch in Washington nicht viel klarzustellen. Nach wie vor gilt die "Gemeinsame Erklärung der USA und Deutschlands zur Unterstützung der Ukraine" vom vergangenen Sommer. Darin verpflichtet sich Berlin zu Sanktionen, falls Russland versuchen sollte, seine politischen Ziele mit Gewalt durchzusetzen. Das schließt ausdrücklich die umstrittene Nord-Stream-2-Röhrenleitung ein.
Die Ampel-Regierung hat an dieser Politik nichts verändert. Trotzdem gibt es in den USA Zweifel an der Verlässlichkeit der Deutschen. Das hat weniger mit dem Bundeskanzler selbst zu tun, als mit der Geräuschkulisse, die seine Partei erzeugt. Bei den Sozialdemokraten gibt es die alten Ungereimtheiten, die kluge Ostpolitik mit falscher Besänftigung verwechseln.
Es gehört schon einige Naivität dazu, die Einkesselung der Ukraine durch 120.000 Soldaten irgendwie weg erklären zu wollen. Oder gar, wie der Altkanzler, das potenzielle Opfer zum Aggressor zu machen. Gerhard Schröder sollte sich schämen, das Geschäft Wladimir Putins zu betreiben. Gewiss, er wird bei Gazprom gut dafür bezahlt.
SPD-Chef Lars Klingbeil nennt Schröders Schwurbeln dessen „Privatmeinung“. Aber auch in der Runde, die er in der Parteizentrale zur Ukraine-Krise zusammengetrommelt hatte, fehlte es einigen an moralischer Klarheit. Mit einer Vogel-Strauß-Politik ist noch nie ein Aggressor besänftigt worden.
Scholz hielt sich der Parteirunde mit Bedacht fern. Denn die Richtlinien der deutschen Außenpolitik werden nicht im Willy-Brandt-Haus, sondern im Kanzleramt bestimmt. Diese Details gehen in der Wahrnehmung auf der anderen Seite des Atlantik schon mal verloren. Deshalb muss der neue deutsche Regierungschef bei seinem Antrittsbesuch im Weißen Haus die Gelegenheit nutzen, klare Worte zu finden.
Der Kanzler sollte froh sein, dass mit Joe Biden dort ein Präsident sitzt, dem die Sicherheit Europas am Herzen liegt. Als eine der ersten Amtshandlungen stoppte der neue US-Präsident den von Donald Trump angeordneten Truppenabzug aus Deutschland. Mit Biden wird es keine Rückkehr der „Einflusszonen“ des Kalten Krieges geben.
Es gibt Verständnis im Weißen Haus für das historisch begründbare Zögern der Deutschen bei Waffenlieferungen an die Ukraine. Die blockierte Freigabe der antiquierten Haubitzen hätte ohnehin eher die Sicherheit ihrer Nutzer gefährdet.
Berlin kann anders helfen; etwa als Mittler in dem Konflikt zwischen Kiew und Moskau. Die eher leisen Töne des Kanzlers ließen sich optimistisch so interpretieren. Zudem ist laut nicht sein Stil. Aber Scholz muss auch nicht Kraftmeiern, um Deutschland klar zu positionieren. Geographisch liegt es näher an Russland, aber die gemeinsamen Werte verbinden es unverbrüchlich mit den USA. Dies öffentlich und bei seinen Gesprächen zu bekräftigen, ist die wichtigste Aufgabe des Kanzlers bei seinem Antrittsbesuch an diesem Montag in Washington.