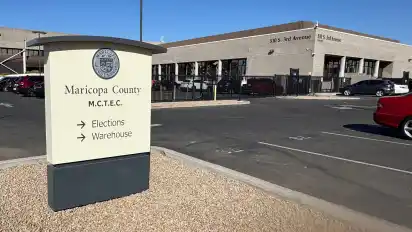Die USA stehen an diesem Dienstag vor einer Schicksalswahl. Und der Rest der Welt hält den Atem an. Denn der Ausgang dürfte gravierende Konsequenzen für alle haben. Für die Amerikaner geht es um das Überleben ihrer freiheitlichen Demokratie. International steht eine Weltordnung auf dem Spiel, in der die Supermacht USA seit dem Zweiten Weltkrieg Sicherheit, Freiheit und Wohlstand garantiert haben.
Kamala Harris versichert allen, die nervös auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen warten, es werde schon gut gehen. Donald Trump repräsentiere nicht, wofür die Amerikaner stünden. Sie kann dafür knapp 250 Jahre an Geschichte ins Feld führen: von der Revolution gegen die britische Krone über die Sklavenbefreiung bis zu den Siegen über Nazi-Deutschland und im Kalten Krieg.
Aber es hat immer auch die Gegenkräfte gegeben, die Amerika zum Beispiel in einen blutigen Bürgerkrieg gestürzt hatten. Isolationisten, die dafür sorgten, dass jüdische Flüchtlinge aus Deutschland nicht ins Land durften. Religiöse Fundamentalisten und antiliberale Kräfte, die Proteste niederknüppelten, Bücher verbannten und Frauen unterdrückten. Dass die USA bis heute keine Präsidentin hatten, ist Teil dieses Erbes.
Wofür stehen die Vereinigten Staaten?
Wofür die Vereinigten Staaten heute stehen, wird sich am 5. November zeigen. Schicken sie einen 78-jährigen Möchtegern-Diktator ins Weiße Haus, der Wladimir Putin bewundert, die größte Massendeportation in der Geschichte des Landes verspricht und seinen Gegnern mit politischer Verfolgung droht? Oder vollzieht das Land mit der Wahl der 60-jährigen Vizepräsidentin einen Generationswechsel und schlägt ein neues Kapitel auf?
Kamala Harris hat es nach dem historischen Rückzug Joe Bidens mit einer disziplinierten Kampagne geschafft, die Wahlen in ein Referendum über Donald Trump zu verwandeln. Das erlaubte der Vizepräsidentin, weniger über die eigene Bilanz und Pläne zu sprechen als über die Amtszeit des Ex-Präsidenten.
Der tat ihr mit seiner „großen Lüge“ von den angeblich gestohlenen Wahlen einen riesigen Gefallen. Denn Trump trat damit praktisch wie ein Amtsinhaber an. Er bestätigte freiwillig alles, wovor Harris die US-Amerikaner warnt: angefangen bei seiner Hetze gegen Einwanderer und Minderheiten über seine frauenfeindliche Rhetorik bis zu der als „Projekt 2025“ bekannten Blaupause für den autoritären Umbau der USA.
Harris versuchte ihrerseits, ein breites Wahlbündnis zu organisieren. Dazu gehören neben der traditionellen Klientel aus städtischen, gebildeten, nicht-weißen und jungen Wählern nun auch moderate Konservative, die sich bei Trumps Maga-Republikanern nicht mehr zu Hause fühlen, und weiße Frauen in den Vororten, die den Abtreibungsextremismus Trumps als Angriff auf ihre persönliche Freiheit verstehen.
Trump setzt mit Hypermaskulinität im Wahlkampf auf ungebildete und frustrierte weiße Männer, die um angestammte Privilegien fürchten – ein Zielpublikum, das die Dauerlügen, Übertreibungen und Hetze mehr unterhaltsam als alarmierend findet. Gegen alle Konventionen bewegte er sich in der heißen Phase des Wahlkampfs nicht in die Mitte, sondern weiter an den Rand. Sein Finale im Madison Square Garden von New York geriet zu einem Hassfest aus offenem Rassismus und Sexismus. Er hofft, mit dem Appell an die niedersten Instinkte ein bis zwei Prozent aus dem großen Pool der Nichtwähler zu mobilisieren.
Dass sich die Umfragen bei einer so klaren Alternative in den sieben umkämpften Swing States alle im Bereich der statistischen Irrtumswahrscheinlichkeit bewegen, ist schockierend. Am Ende werden ein paar Tausend Stimmen mehr oder weniger in Wahlbezirken mit vielen Wechselwählern entscheiden, wer ins Weiße Haus zieht.
Leider dürfte es in der Wahlnacht noch keine Klarheit über den Ausgang der Schicksalswahl geben. Es sei denn, die Meinungsforscher lagen mit ihren Umfragen daneben. Zum Beispiel, weil sie die Entschlossenheit der Frauen unterschätzt haben, diesen Mann nicht zurück ins Weiße Haus zu lassen.